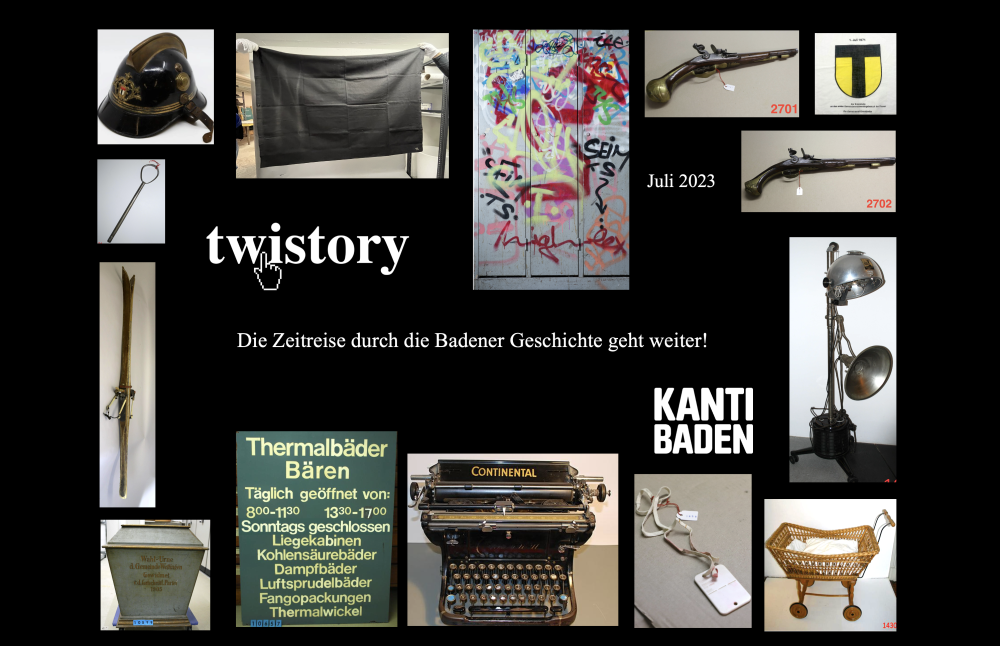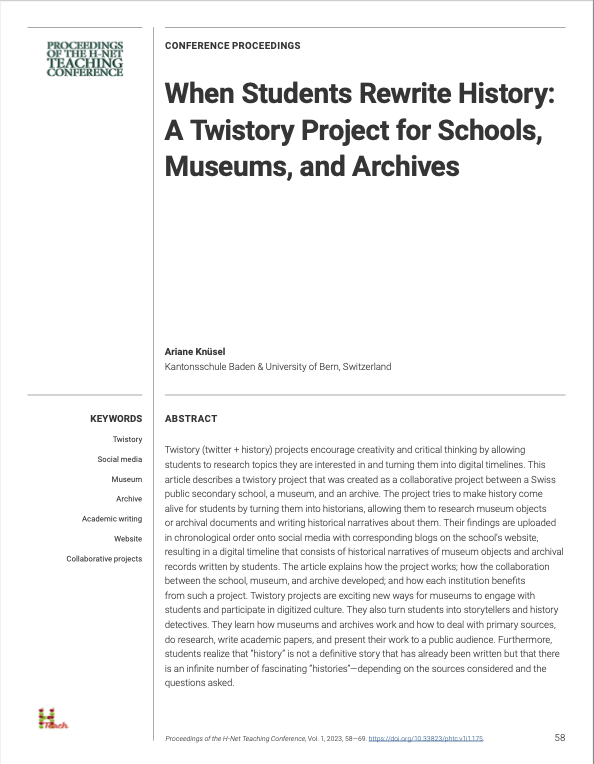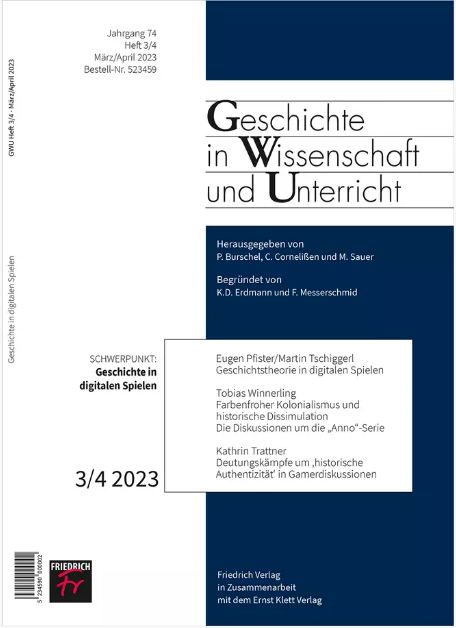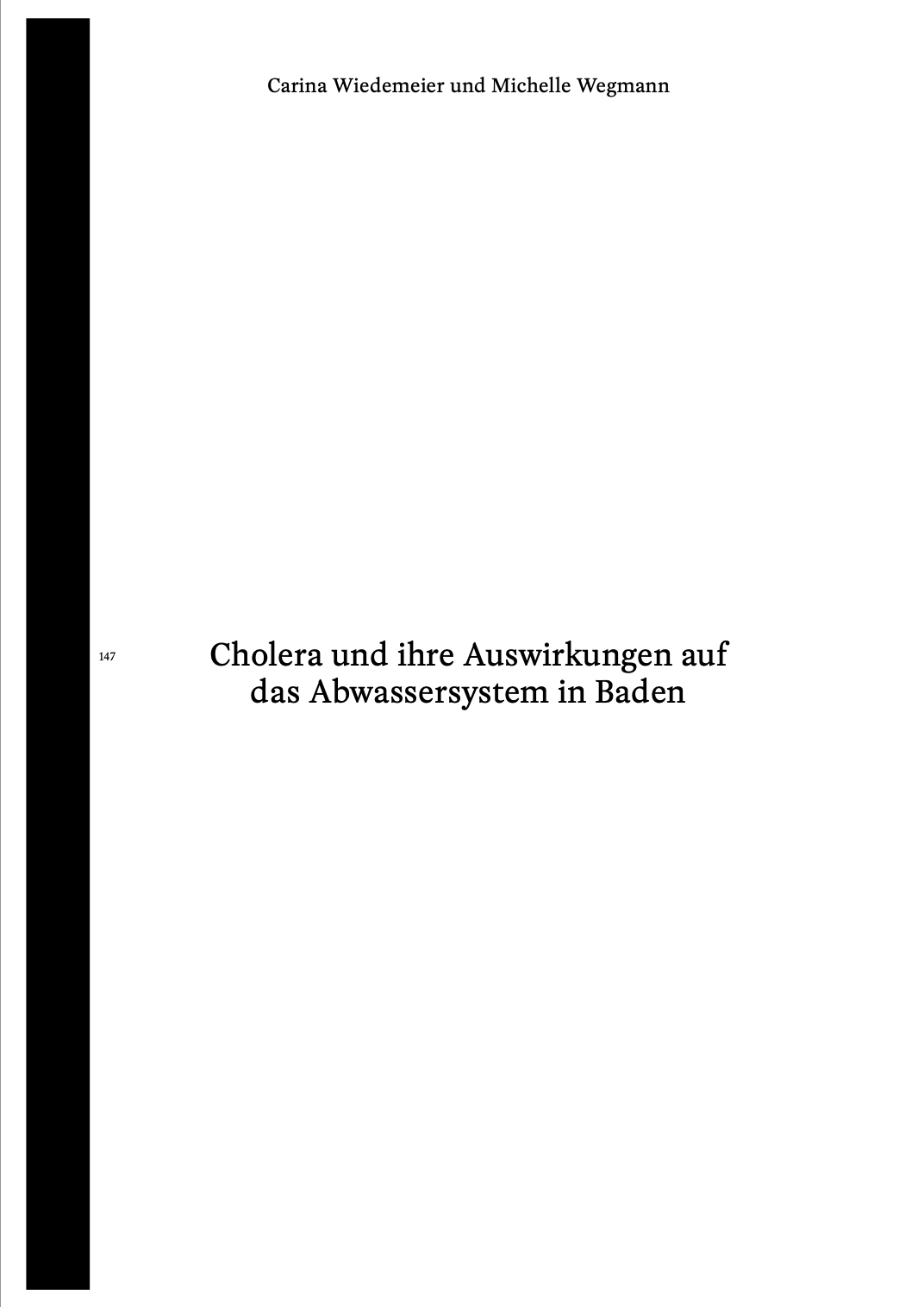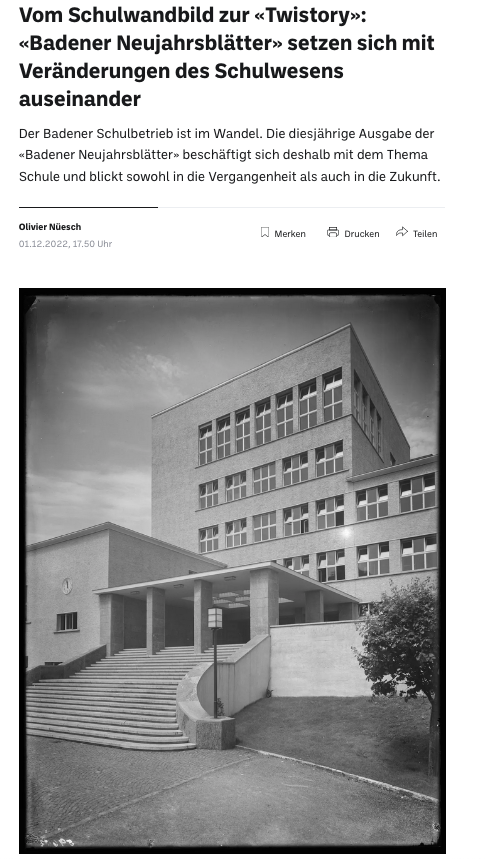Ein Projekt zur Badener Geschichte von Kantischülerinnen und Kantischülern
Worum geht’s?
In einer Schweizer Premiere untersuchen an der Kantonsschule Baden seit 2021 Schülerinnen und Schüler Museumsobjekte und Archivdokumente zur Geschichte Badens. Sie erforschen, was uns die Quellen über das Leben in Baden verraten und gestalten dazu eine virtuelle Timeline mit einzigartigen Einblicken in die Geschichte Badens (Twitter + History = Twistory) mit Blogeinträgen, wissenschaftlichen Arbeiten und Posts in sozialen Medien. Am 20.6.2024 findet der nächste Anlass im Historischen Museum Baden statt.
Wie funktioniert das Twistory-Projekt?

Schülerinnen und Schüler der Kanti Baden wählen aus hunderten von Objekten aus dem Historischen Museum Baden und über tausend Dokumenten aus dem Badener Stadtarchiv Quellen aus. Sie können ihre Quellen auch vor Ort im Museum begutachten und im Archiv recherchieren. In einem ersten Schritt machen sie historische Detektivarbeit und recherchieren den Kontext, in dem die Quelle entstand: Wie und von wem wurde das Objekt benutzt? Was passierte, als das Dokument geschrieben wurde? Was verrät uns die Quelle über die damalige Gesellschaft und das Leben in Baden?
Ihre Erkenntnisse halten die Schülerinnen und Schüler in einer wissenschaftlichen Arbeit fest. Aus den Arbeiten gestalten sie in einem zweiten Schritt Blogeinträge. In einem dritten Schritt werden auf den sozialen Medien (Instagram) in chronologischer Reihenfolge der Quellen Stories zu den einzelnen Quellen veröffentlicht. Zu den Stories werden auf dieser Webseite jeweils die dazugehörigen Blogtexte veröffentlicht (siehe unten).
So entsteht eine virtuelle Timeline zur Geschichte Badens, die jedes Jahr durch weitere Quellen und Blogs von Schülerinnen und Schülern ergänzt wird. Die beste Arbeit wird zudem jedes Jahr in den Badener Neujahrsblättern veröffentlicht.
Das Projekt wurde von Ariane Knüsel für die Kanti Baden geschaffen. Es ist das erste seiner Art.
Twistory im Museum

Die erste Runde des Twistory-Projektes ging im Schuljahr 2021/2022 über die Bühne. 2022/2023 befassten wir uns anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Badenfahrt mit Objekten von früheren Badenfahrten. Auch dieses Schuljahr schreiben die Schülerinnen und Schüler wieder die Geschichte Badens anhand von Museumsobjekten neu. Untersucht werden u.a. Qilin-Statuen aus China, eine Hellebarde, medizinische Instrumente für den Aderlass, ein Kleid im Rokoko-Stil, Pläne für ein neues Grand Hotel, ein Gewehr, Rationierungscoupons und ein Pokal für Modellfliegen.
Am Donnerstag, 20.6.2024 stellen die Schülerinnen und Schüler ihre Recherchen im Historischen Museum Baden der Öffentlichkeit vor. Wir freuen uns, wenn auch Sie vorbeikommen!
Twistory 2024

Seit dem 3. Juni 2024 erscheinen die Blogeinträge des aktuellen Twistory-Jahrganges jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag in chronologischer Reihenfolge hier auf der Webseite. Der neueste Eintrag ist immer mit einem Stern gekennzeichnet.
Am Donnerstag, 20. Juni 2024, erzählen die Schülerinnen und Schüler im Historischen Museum Baden ab 17:30 Uhr von ihren Nachforschungen und Erkenntnissen zusammen mit den Originalobjekten aus dem Historischen Museum. Wir freuen uns, wenn auch Sie vorbeikommen!
Anmeldung bis Dienstag, 18. Juni, an hc.nedab-itnak@leseunk.enaira
Die Twistory Timeline zur Geschichte Badens
Pestlöffel (17. Jh.)

Die Pest – eine grausame Krankheit, welche von dem Bakterium Yersinia Pestis verursacht wird. Diese hochansteckende Krankheit hat die Menschen im Laufe der Zeit einige Male in Angst und Schrecken versetzt. Im Mittelalter hat die Pest, auch der «Schwarze Tod» genannt, ein Drittel der Bevölkerung in Europa ausgelöscht. Doch dies war nicht die einzige Epidemie. Im Laufe der Geschichte kam es immer wieder zu tragischen Pestepidemien mit unzähligen Toten. Ebenfalls blieben die Menschen im 17. und 18. Jahrhundert nicht vor der Pest nicht verschont. Die Große Pest nahm etwa hunderttausend Menschen das Leben.
Aufgrund des spannenden Themas konnten wir den Pestlöffel im Historischen Museum Baden nicht übersehen. Der Löffel stammt aus der Zeit um das 17./18. Jahrhundert und sollte mit der Medizinvergabe an die Kranken zu tun haben. Wir haben ausgiebig recherchiert zur Funktion und zum Aussehen von Pestlöffeln und mussten erkennen, dass der Pestlöffel aus dem Historischen Museum sich von den bekannten Pestlöffeln unterscheidet.
Der Ursprung des «Originalen Pestlöffel» liegt in der katholischen Kirche, im Zeitraum um das 17./18. Jahrhundert. Einer der wohl bekanntesten Pestlöffel ist der Tegernsee Pestlöffel. Er wurde nach der Epidemie der Großen Pest angefertigt, da im Tegernseer Tal viele Menschen gestorben sind. Die Kirche hatte dazumal eine enorm große Bedeutung für die Bevölkerung. Viele Menschen verstanden die Pest als eine Strafe Gottes. Sie sahen die Pest als eine Art Dämon oder Flämmchen, welches von Gott geschickt worden ist. Die Menschen gingen wieder vermehrt in die Kirche, um sich von ihren Sünden zu befreien. Es war den Erkrankten wichtig, die Kirchenbesuche weiterhin beizubehalten und den Glauben zu pflegen. Diese meist sehr langen Löffel wurden daher zum Schutz der Pfarrer eingesetzt. Damit konnten sie den Pest-Infizierten die heilige Kommunion überreichen, ohne den Menschen zu nahe zu kommen.
Den Menschen war es damals schon bekannt, dass man bei einigen Krankheiten Abstand halten muss. Sie merkten schnell, dass dies auch bei der Pest der Fall ist. Genau aus diesem Grund sind die Pestlöffel entstanden. Die typischen Löffel sind meist um die 50-55cm lange Silberlöffel mit einer vergoldeten Schaufel. Der Löffel des Historischen Museum Baden sieht jedoch diesem „Ideal“ nicht ähnlich. Er ist deutlich kürzer und besitzt vorne keine vergoldete Schaufel. Stattdessen besitzt er vorne ein eher zu großes Loch, welches uns eine Idee für die logische Anwendung erschwert. Laut den Informationen des Museums, wurde er zum Überreichen von Medizin genutzt. Wir haben leider keine Anhaltspunkte, die diesen Anwendungszweck bestätigen könnten.
Welchen Bezug der Pestlöffel mit Baden hat, können wir leider nicht detailliert erklären. Jedoch steht fest, dass es um das Jahr 1626 eine Pestepidemie in Baden gab, die viele Todesfälle forderte. Von den ganzen Feiertagen, die wir jedes Jahr haben, ist klar, dass Baden eine katholische Stadt ist, welches eine katholische Kirche besitzt. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Löffel in dieser Kirche genutzt worden ist und der Löffel somit im Zusammenhang mit Baden stehen könnte.
Aufgrund der allgemeinen mangelnden Informationen über den Pestlöffel können wir vieles nicht erläutern und oft nur Vermutungen aufstellen. Dadurch, dass die Merkmale des «Originalen Pestlöffels» nicht mit denen des Exemplars übereinstimmen, das im Historischen Museum Baden ausgestellt ist, bleibt dieser Löffel ein kleines Mysterium.
Ana, Kyra, Malin
Steinschlosspistole (1650)

Kriege haben seit jeher existiert und werden wahrscheinlich auch weiterhin stattfinden, da der Mensch oft nicht aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Leider führen Kriege zu unzähligen Verlusten von Menschenleben. In diesem Kontext spielte die Steinschlosspistole eine bedeutende Rolle. In unserem Twistory-Projekt lag unser Fokus auf dieser Steinschlosspistole, die durch ihren einzigartigen Mechanismus einen grossen Schritt in der Waffenindustrie bedeutet hat.
Die Steinschlosspistole war eine historische Feuerwaffe, die im 16. bis 19. Jahrhundert Verwendung fand. Ihr Steinschlossmechanismus unterschied sie von anderen Pistolen und brachte eine Waffenrevolution mit sich. Dadurch verbreitete sich die Pistole rasch auf der ganzen Welt. Allerdings war ihre Verwendungsdauer begrenzt, da der Mechanismus die Erfinder und Erfinderinnen dazu inspirierte, effizientere und leistungsstärkere Pistolen zu entwickeln.
Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert kam es in der Schweiz zu zahlreichen kleineren Kriegen, an denen zum Teil auch die Stadt Baden beteiligt war. Infolgedessen wird vermutet, dass die Einwohner und Einwohnerinnen von Baden aus Sicherheitsgründen Steinschlosspistolen verwendeten. Neben dem Einsatz in Kriegen fand diese Pistole auch im Alltag Verwendung. Insbesondere der Adel besass sie, und sie wurde auch für sportliche Aktivitäten wie dem Schiesssport und der Jagd eingesetzt. Die Steinschlosspistole wurde sowohl von Zivilisten als auch vom Militär genutzt und wies einige interessante Unterschiede zu anderen Pistolen auf. Um ihre Funktionsweise zu verstehen, betrachten wir den Lade- und Schussvorgang:
Anstelle moderner Munition verwendete die Steinschlosspistole Schwarzpulver als Treibmittel. Beim eigentlichen Schussvorgang wurde die Pfanne der Pistole mit Schwarzpulver gefüllt. Durch den Schlag des Feuersteins entstand ein Funke, der das Schwarzpulver entzündete. Die Zündung erfolgte, indem ein Feuerstein gegen eine Metallplatte geschlagen wurde, was zu einer Funkenbildung führte. Die Explosion des Schwarzpulvers erzeugte einen hohen Druck im Lauf, der das Geschoss vorantrieb und den Schuss abfeuerte. Allerdings musste die Steinschlosspistole nach jedem Schuss mühsam neu geladen werden, was als großer Nachteil dieser Waffe betrachtet wurde. Im Laufe der Zeit wurde die Steinschlosspistole von der fortschrittlicheren Perkussionspistole abgelöst, die über eine weiterentwickelte Technologie verfügte. Dennoch bleibt die Steinschlosspistole eine faszinierende Erfindung vergangener Zeiten, die uns an den Ursprung von Schusswaffen erinnert und Einblick in ihre besondere Funktionsweise gewährt.
Die Steinschlosspistole aus dem 16. Jahrhundert beeindruckt durch ihren langen, glatten oder geriffelten Lauf, der aus robustem Eisen oder Stahl gefertigt war. Der Schaft bestand aus Holz und verlieh der Pistole einen elegantes und ansprechendes ansehen. Doch neben ihrer Funktionalität und Handwerkskunst spielte die Steinschlosspistole auch eine bedeutende Rolle in der Kunstgeschichte. Sie diente als Symbol für Macht und Status und wurde oft mit kostbaren Materialien wie Gold, Silber, Edelsteinen oder Elfenbein verziert. Diese kunstvoll verzierten Steinschlosspistolen wurden in den Händen des Adels zu wertvollen Besitztümern, die seinen sozialen Stand und seine Pracht zur Schau stellten. Darüber hinaus wurden sie auch in der Diplomatie verwendet, wo sie als Geschenke zwischen Adligen ausgetauscht wurden, um Beziehungen zu festigen.
Heutzutage wird die Steinschlosspistole in der Kunst bewundert. In vielen Museen auf der ganzen Welt werden sie ausgestellt. Sammler schätzen sie als wertvolle Sammlerstücke. Diese Pistolen geben uns einen Einblick in die Vergangenheit. Sie erinnern uns an die Anfänge der Schusswaffen und verdeutlichen die technologische Entwicklung im Laufe der Jahrhunderte. Obwohl die Steinschlosspistole heute keine Verwendung mehr findet und von modernen Pistolen abgelöst wurde, bleibt sie ein Symbol für die frühe Entwicklung der Feuerwaffen. Sie erinnert uns daran, wie sich Technologien im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben und wie die Menschheit ihre Waffen immer weiter verbessert hat. Ihre einzigartige Funktionsweise, ihre Bedeutung in Kriegen und im Alltag, ihre kunstvolle Verzierung und ihr historischer Wert machen sie zu einem faszinierenden Thema der Forschung und des Interesses für Geschichts- und Waffenliebhaber. Während wir auf die Vergangenheit zurückblicken, können wir aus den Errungenschaften und Fehlern dieser Zeit lernen und unsere Bemühungen darauf richten, eine friedlichere Zukunft zu gestalten.
Drazen, Yannick, Mert, Sian
Steinschlosspistole (1735)

Die Waffenentwicklung spielt bis heute eine bedeutende Rolle, da sie direkten Einfluss auf weltweite Konflikte und Kriege hat. Insbesondere die Erfindung der Feuerwaffen hat es ermöglicht, im Kampf strategische Vorteile zu erlangen.
Im 18. Jahrhundert durchlebte die Waffenentwicklung eine faszinierende Revolution, insbesondere im Bereich der Feuerwaffen. Von den primitiven Vorderladern und den unzuverlässigen Luntenschlössern bis hin zur technischen Eleganz der Steinschlossmechanismen. Unser Objekt ist eine solche Steinschlosspistole, die aus dem Jahr 1735 stammt. Seit 1995 hat sie einen Platz im Historischen Museum von Baden.
Unsere Steinschlosspistole wurde aus einem edlem Walnussholz gefertigt, das für seine Schönheit und Lebendigkeit bekannt ist. Es ist ein begrenzt verfügbares Holz, da es hauptsächlich für die Ernte von Walnüssen angebaut wird. Das Walnussholz ist aufgrund seiner hohen Dichte sehr robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verrottung, was es zu einem idealen Material für Feuerwaffen macht. Oftmals, so auch bei unserer Waffe, verwendete man hochwertigen Stahl, um den Lauf herzustellen. Stahl hat dank seines hohen Kohlenstoffgehalts die Eigenschaft sich gut Formen zu lassen und schnell auszuhärten.
Früher wurde auch besonderer Wert auf das Aussehen von Waffen gelegt, weswegen unsere Steinschlosspistole mit kunstvollen Gravuren verziert ist. Die goldenen Ornamente zeigen einen Löwen und einen Hirsch. Der Löwe galt schon im antiken Griechenland als Symbol für Tapferkeit und edle Herkunft. Der Hirsch wird in der Bibel als Zeichen der Heilung und Wiederherstellung beschrieben. Diese Ornamente sollten die Stärke und Tapferkeit des Trägers symbolisieren und ihm im Kampf Kraft und Heilung verleihen.
Das Steinschloss war eine wegweisende Innovation im Bereich der Feuerwaffen. Als Nachfolger des Lunten- und Radschlosses führte es einen Feuerstein ein, der Funken erzeugte und das Schwarzpulver entzündete. Durch den geschickten Einsatz des Hahns wurde der Zündmechanismus gesteuert und die Schwarzpulverladung im Lauf entfacht, was letztendlich zum Ausstoß der Kugel führte. Diese bedeutende Entwicklung legte den Grundstein für weitere Fortschritte in der Feuerwaffentechnologie und markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Waffenentwicklung.
Die Frage nach der Herkunft unserer Waffe ist interessant: Nach umfangreichen Recherchen sind wir auf zwei mögliche Ursprungsorte gestoßen. Im 18. Jahrhundert gab es in Europa eine Vielzahl von Erbfolgekriegen, darunter der berühmte Spanische Erbfolgekrieg und der polnische Erbfolgekrieg. Im Zusammenhang mit einem dieser Kriege könnte unsere Waffe geschmuggelt und in der Schweiz verkauft worden sein. Die Schweiz, insbesondere die Region Baden, spielte aufgrund ihrer geografischen Lage möglicherweise eine bedeutende Rolle bei der Verbreitung von Steinschlosspistolen. Es wird vermutet, dass die Schweiz sowohl den Großmächten gedient als auch eine eigene Produktion von Steinschlosswaffen unter dem bernischen Regime hatte. Die bernische Regierung kontrollierte das Land und betrieb Waffenproduktionen in Brugg, die mit Steinschlosswaffen in Verbindung standen. Daher besteht die Möglichkeit, dass unsere Steinschlosspistole entweder während des polnischen Erbfolgekrieges in die Nordschweiz gelangt ist oder direkt im Aargau hergestellt wurde.
Waffen sind weltweit verbreitet und ein wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte. Auch heute noch kann man sagen, dass die Feuerwaffe viele Menschen fasziniert und beeindruckt. Nicht Wenige haben es sich zur Aufgabe gemacht, Schusswaffen zu sammeln und ihren historischen Hintergrund genauer zu erforschen.
Iris, Leon, Thessa, Gabriele
Hellebarde (18. Jh.)

Unser Objekt ist eine Hellebarde oder Halbarte, wie sie auch genannt wird. Sie wurde vom Museum auf die Zeit 1700-1800 datiert. Aber Moment mal - jetzt wird wahrscheinlich sofort jeder Kenner der Militärgeschichte stutzen: 18. Jahrhundert? Wieso sollten in dieser Zeit noch neue Hellebarden hergestellt worden sein, waren da nicht längst die Nahkampfwaffen (oder Schlag- und Stosswaffen) durch Feuerwaffen ersetzt worden? Die Antwort hierauf lautet: „Ja und Nein.“
Noch rätselhafter mag es werden, wenn man diesen speziellen Halbarten-Typus genauer anschaut und feststellt, dass er sehr massiv, kompakt, mit grossem Schnabelhaken und besonders materialintensiv gefertigt wurde. Denn vor allem Letzteres bedeutete damals, dass dadurch der Preis stark in die Höhe getrieben wurde, so dass dieser Typus praktisch unerschwinglich war für die kriegspflichtigen Wehrleute. Diese waren in unserer Eidgenossenschaft vom frühen Mittelalter bis ins 19. Jh. aus der einfachen und ärmeren Stadt- und Landbevölkerung zusammengesetzt und mussten ihre Ausrüstung (die meist unvollständig und unzulänglich blieb) selbst beschaffen.
Übrigens betraf die Kriegspflicht in der Stadt Baden im 16. Jh. ⅕ bis ¼ aller Bürger: Ihre Aufgabe war, in Pikettdiensten die Ringmauer und die Burganlagen zu verteidigen. Ausserdem hatten sie eine „Stossreserve“ zu stellen, das heisst für eidgenössische Kriegszüge parat zu sein.
Wozu dann diese massenhafte Herstellung eines solch kostspieligen, fast schon obsoleten Waffentyps? Und ja, man kann wirklich von einem Hype sprechen, wenn man in die Auftragsbücher der entsprechend spezialisierten Huf- und Waffenschmiede dieser Zeit schaut. (Einer dieser begabten und tüchtigen Schmiede arbeitete seit den 1660er Jahren in Würenlos: seine Schmiede hatte er vom Kloster Wettingen als Lehen erhalten und unterstand somit der Grafschaft Baden. Seine Meistermarke hat grosse Ähnlichkeit mit der Marke auf unserem Museumsobjekt!)
Auch unsere Museen sind voll von diesem Halbarten-Typ, der sogenannten Sempacher Halbarte, vor allem in Zürich, Bern, Solothurn, Schwyz und im Aargau.
Die Antwort, die wir gefunden haben, lautet: Propaganda wirkt! Der Mythos vom wehrhaften Eidgenossen mit der ikonischen Hellebarde war so fest verankert in den Köpfen - sogar der Eidgenossen selber - , dass er uns tatsächlich gegen Ende des 17. bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine Renaissance der Halbarte bescherte. Ausschlaggebend für diese „Massenproduktion“ war ein Wettrüsten, das nach dem Ersten Villmergerkrieg (1656) begann. In diesem „Konfessionskrieg“ wurden die für damalige Verhältnisse recht modern ausgestatteten reformierten Berner Truppen von den katholischen, ungestümen, überwiegend mit Stangenwaffen ausgerüsteten Heerhaufen vernichtend geschlagen.
Anstatt im Anschluss eine ordentliche militärische Analyse durchzuführen, waren die gedemütigten Berner zunächst dem Mythos der überlegenen Halbarten aufgesessen. Da die religiösen Spannungen weiterhin gross waren, wurden nun neue Hellebarden entwickelt, die nach alten Vorbildern und in Erinnerung an die weiter zurückliegende Hellebarden-Schlacht bei Sempach (1386) für Ruhm und Glanz der jeweiligen Parteien sorgen sollten. Auch die Zeughäuser (Waffenkammern) der Festung Stein bzw. des Tagsatzungsorts Baden als militärischem Bollwerk wurden von den katholischen Orten mit diesen Sempacher Halbarten ausgestattet.
Das Kuriose war hier, dass diese gehypten Prachtexemplare gar nicht zum Einsatz kamen, als 1712 der Zweite Villmergerkrieg über Baden und andere Regionen hereinbrach; die Sempacher Halbarten blieben ungenutzt und „unschuldig“. Die Berner nämlich hatten sich doch noch rechtzeitig auf ihre moderne Kampftaktik besonnen und die Badener wiederum, die nach einem Tag der Belagerung der Festung Stein endgültig kapitulierten, gerieten in gar keine Nahkampf-Situationen, in denen sie hätten eingesetzt werden können. Dies bedeutete jedoch nicht, dass überhaupt keine Hellebarden mehr verwendet wurden. Im Gegenteil: Die alten, weitervererbten oder erbeuteten Varianten im Besitz der ärmeren Kriegsleute waren als Allzweckwaffen bis ins 18. Jahrhundert auf beiden konfessionellen Seiten durchaus beliebt.
In diesem Krieg nun wurden die katholischen Orte, und damit Baden, vernichtend geschlagen. Das hatte für Baden weitreichende Konsequenzen: Als Kriegsbeute musste es seine gesamten Waffen, mitsamt den Sempacher Halbarten und jegliche Kostbarkeiten an die Sieger abgeben, es verlor seinen zuvor herausragenden Status als Tagsatzungsort, die Grafschaft verarmte und verfiel immer mehr. Erst ab 1815 ging es mit der Stadt infolge der Gründung des eidgenössischen Staatenbundes schliesslich wieder bergauf.
Totentanzfigur (1800-1850)
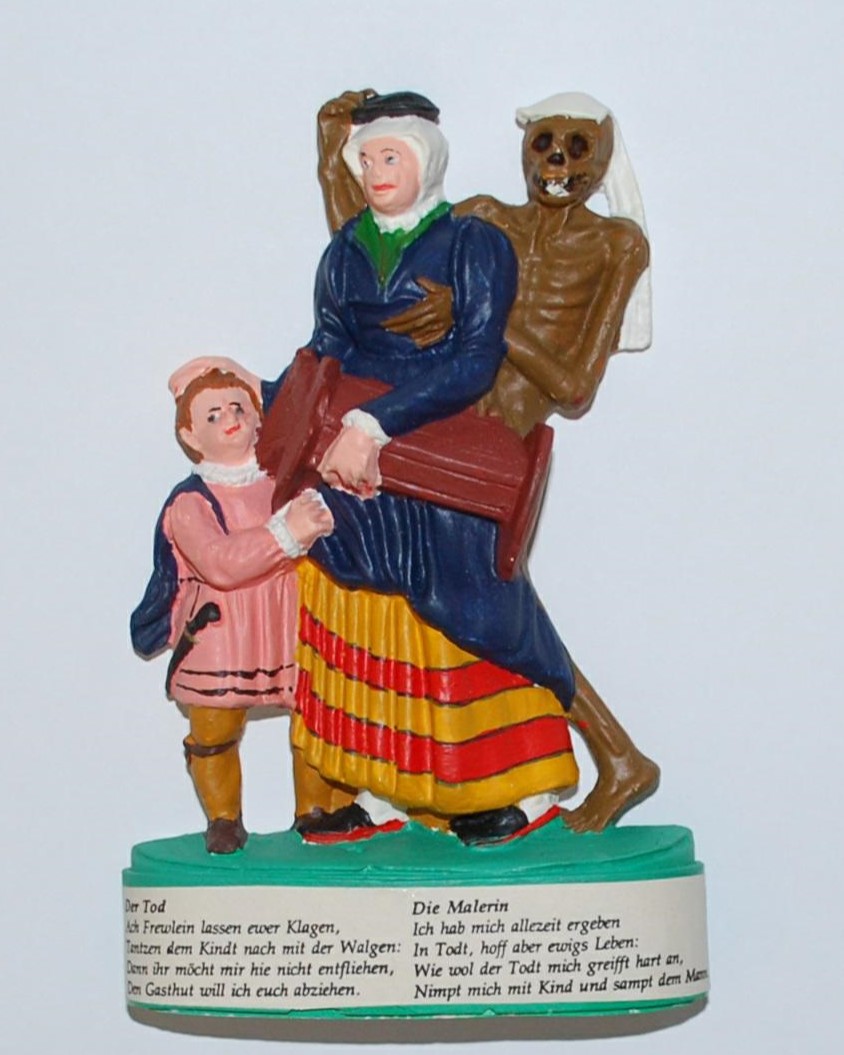
Totentanzfiguren sind ein mysteriöses und faszinierendes Thema, das uns in seinen Bann gezogen hat. Der Name allein wirft Fragen auf und lässt Raum für Spekulationen. Was verbirgt sich hinter diesen ungewöhnlichen Skulpturen? Wir nahmen eine Totentanzfigur aus dem Historischen Museum zum Anlass, uns eingehend mit Totentanzfiguren zu befassen, ihre Geschichte zu erforschen und zu verstehen, was sie über das Leben in Baden und darüber hinaus aussagen.
Totentanzfiguren sind Skulpturen, die aus Ton, Terrakotta, Holz oder Metall angefertigt sind. Sie zeigen oft zwei Gestalten, die tanzen oder sich berühren. Eine Figur repräsentiert einen Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten und trägt Symbole des alltäglichen Lebens, während die andere den Tod verkörpert. Diese Figuren sollen die Vergänglichkeit des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Todes darstellen - eine Mahnung an die Betrachter, über ihre eigene Sterblichkeit nachzudenken.
Der Ursprung des Totentanzes ist vielschichtig und nicht eindeutig zu bestimmen. Es ist möglich, dass der Totentanz von der Kirche benutzt wurde, um die Leute davon abzubringen, nach Beerdigungen auf Gräbern zu essen, singen und zu tanzen, um den Toten zu gedenken.
Totentanzfiguren breiteten sich ab dem späten 14. Jahrhundert in Europa. Pest und soziale Veränderungen zur Folge, dass sich Menschen intensiv mit dem Tod auseinandersetzten. Die Angst vor dem Tod spiegelt sich möglicherweise in der Entstehung und Verbreitung der Totentanzfiguren wider, denn dort werden Menschen jedes Standes mit dem Tod konfrontiert und es gibt kein Entrinnen.
Im 15. Jahrhundert spielten Totentanzfiguren eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Für die Kirche waren sie ein Mittel der Kontrolle, moralischen Erziehung, und um Spenden zu sammeln, während sie für das Volk nicht nur eine Quelle der Furcht, sondern auch des Trostes darstellten. Für die Künstler waren sie eine Möglichkeit der sozialen Kritik und der Selbstreflexion.
Genau dieser Punkt wird auch auf unserer Keramikfigur im Museum betont. Die Figur stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie stellt eine Szene vom sogenannten Basler Totentanz dar, einer riesigen Wandmalerei, die im 15. Jahrhundert an die Friedhofsmauer bei der Basler Predigerkirche gemalt wurde. Darauf sieht man dutzende von Personen, die mit dem Tod tanzen. Der Sockel der Figur ist rundherum mit einem Spruchband bedruckt. Die Texte handeln davon, dass eine Malerin und ihr Kind, ein Kaufmann, eine Edelfrau, ein Narr und ein «Krüppel» vom Tod heimgesucht werden und ihm nicht entkommen können. Die Frau («Malerin») beispielsweise hofft auf ein ewiges Leben nach dem Tod und ist traurig, dass sie mit ihrem Kind sterben wird. Doch der Tod erwidert, dass sie statt zu klagen mit dem Kind tanzen soll, da sie ihm nicht entfliehen können.
Der Sensenmann, eine Symbolfigur des Todes, ist seit Jahrhunderten in der westlichen Kultur präsent. Als Skelett oder in schwarzer Kleidung mit einer Sense in der Hand symbolisiert er die Vergänglichkeit des Lebens und die Unvermeidlichkeit des Todes. Heute ist der Tod ein Thema, über das wir nur selten sprechen, obwohl jeder eine Vorstellung davon hat, was nach dem Tod passiert. Doch man wird trotzdem immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Im Park des Kantonsspitals Baden erschuf deshalb Albert Siegenthaler 1978 das Kunstwerk «Der Totentanz».
In der Schweiz findet man traditionelle Totentänze als Wand- und Glasmalereien, Skulpturen, Reliefs und Figuren. Sogar Totentanzlieder und Tänze wurden (und werden) aufgeführt. Sie bieten einen faszinierenden Einblick in die Gedankenwelt vergangener Generationen und lassen uns über die Vergänglichkeit des Lebens nachdenken. Sie sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch historische Zeugnisse einer Zeit, in der der Tod allgegenwärtig war und die Menschen dazu zwang, sich mit ihrer eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Durch ihre Darstellung erinnern sie uns daran, dass das Leben kurz ist und der Tod unausweichlich. Sie laden uns ein, über die Endlichkeit des Lebens und die Bedeutung des Todes nachzudenken – eine Erinnerung, die auch heute noch von grosser Bedeutung ist.
Aderlass-Schnepper (1800-1870)

Da der Aderlass heute nicht mehr wirklich oft verwendet wird, stellt sich zuerst einmal die Frage: Was ist der Aderlassschnepper überhaupt genau und was macht er?
Beim Aderlassschnepper handelt es sich um medizinisches Instrument, das im Mittelalter erfunden wurde. Im Historischen Museum Baden gibt es ein Exemplar aus dem 19. Jahrhundert (1800-1870). Er besteht aus Messing und Stahl misst 15x6 cm. Es wurde eine Klinge an einen Federmechanismus gespannt, welche durch einen kleinen Hebel ausgelöst werden konnte. Dies ermöglichte es der Klinge, blitzartig durch die Wand von Blutgefässen zu schnellen. Bei einigen Modellen konnte die Eindringtiefe sogar exakt eingestellt werden! Doch, wieso tat man so etwas überhaupt?
Zum einen spielte die Vier-Säfte-Lehre im Mittelalter eine wichtige Rolle. Man glaubte, dass der Körper aus vier zentralen Säften besteht: Blut, Schleim, gelber Galle und schwarzer Galle. Ein Ungleichgewicht der Säfte, so die Annahme, könne zu physischer oder mentaler Krankheit führen. Bei Krankheiten wie Fieber, Schlaganfälle oder Kopfschmerzen wandten Ärzte des Mittelalters deshalb den Aderlass an, um die Körpersäfte wieder auszubalancieren.
Beim Aderlass wurde das Blut durch chirurgisches Öffnen einer Vene entnommen. Der Aderlassschnepper war ein Instrument, das bei der Durchführung dieser Praxis unverzichtbar war. Beim Verfahren wurde eine Staubinde am Oberarm des Patienten befestigt, welcher meist einen aus der Erde stehenden Stab festhielt, um seinen Arm möglichst ruhig zu halten. Je nach Leiden wurde man an verschiedenen Körperstellen zur Ader gelassen. Auch die Menge Blut, welche entnommen wurde, war je nach Arzt und Krankheit unterschiedlich. So gab es Ärzte, welche den Aderlass erst abbrachen, wenn der Patient kurz vor der Ohnmacht stand. Nachdem das Blut entzogen wurde, wurde die Binde wieder geöffnet und ein Verband angelegt.
Der Zeitpunkt des Aderlasses wurde sorgfältig gewählt, basierend auf der Mondphase und dem Stand der Planeten, da man glaubte, dass er nur unter bestimmten kosmischen Bedingungen effektiv sei. Es wurde angenommen, dass er nur in den ersten sechs Tagen bei abnehmendem Mond helfe. Man war der Meinung, dass das Blut und die fauligen Flüssigkeiten sonst zu gut vermischt seien, um das überschüssige Blut genügend vom Guten trennen zu können.
Wie an vielen Orten zu jener Zeit, wurde der Aderlassschnepper auch in Baden verwendet, besonders in den Bädern. Denn diese waren früher wegen ihrer heilenden Wirkung beliebt. Man dachte, dass Thermalbäder in Kombination mit dem Aderlass die Heilung von Krankheiten beschleunigten, weil die Wärme des Thermalwassers die Muskulatur entspannte und das Bindegewebe dehnbarer machte. Die erweiterten Blutgefässe ihrerseits förderten die Durchblutung und unterstützten die heilenden Effekte des Aderlasses.
Die Kombination von Bad und Aderlass zeigt, wie noch im 19. Jahrhundert in Baden unterschiedliche medizinische Praktiken und Heilmethoden miteinander verknüpft wurden, um Krankheiten zu heilen und die Gesundheit zu fördern.
Während die Badener Bäder noch heute auch für gesundheitliche Zwecke besucht werden, gilt der Aderlass heute in der Schulmedizin als “veraltet” und “überholt”. Die meisten Leute wissen gar nicht, was ein Aderlassschnepper ist. Das Instrument im Historischen Museum Baden erzählt uns deshalb nicht nur von den Heilmethoden vergangener Generationen, sondern auch von der Technologie vergangener Zeiten.
Aderlass-Apparat (1800-1870)

Es ist kein Geheimnis, dass wir Menschen seit geraumer Zeit die kuriosesten Dinge tun oder benutzten, um unsere Gesundheit zu fördern und böse Krankheiten abzuwehren. So auch mit dem Aderlass-Schnepper. Als wir im Historische Museum Baden stöberten, fiel uns dieser kleine unscheinbare Apparat ins Auge. Nachdem wir von unseren Lehrpersonen hörten, was der Nutzen des Apparates sei, waren wir alle sehr interessiert (und auch ein wenig angeekelt), aber wollten vor allem mehr darüber erfahren.
Diesen kleinen, wenige Zentimeter grossen, achteckigen Apparat bezeichnet man als Aderlass-Schnepper. Die Messingapparatur ist mit 16 kleinen Messern ausgestattet, welche nur aus dem Gehäuse hervorschauen, wenn man den kleinen Hebel auf der Oberseite betätigt. Zusätzlich hat das Gerät einen Knopf an der Seite, der die Messer blockieren kann und ein Verstellrad auf der Oberseite des Schneppers.
Der Aderlass-Schnepper wurde vor allem bei Entzündungen oder Blutkrankheiten eingesetzt. Man legte den Apparat den Patienten auf die Haut und betätigt den Hebel. Die 16 Messerchen verursachten kleine Schnitte, aus welchen das Blut quoll. Damit sollte unreines Blut aus dem Körper fliessen. Man war nämlich überzeugt, dass die Zusammensetzung der Körpersäfte die Gesundheit beeinflusste.
Der Aderlass-Apparat wurde über die Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Er wurde bereits von den alten Griechen und Römern verwendet. Im Mittelalter wurde seine Verwendung massgeblich Hildegard von Bingen geprägt. Die Nonne war eine Gelehrte im Bereich der Naturmedizin und eine der Ersten, die den Aderlass und damit verbundene Geräte detailliert in Büchern dokumentierte. In ihren Schriften erklärte sie die Prinzipien des Instruments und gab Anleitungen zur Verwendung. Gottfried Hertzka übernahm 800 Jahre später einen Grossteil der Theorien von Bingens und gründete die sogenannte «Hildegard-Medizin».
Im Mittelalter liessen Erwachsene etwa zwei Mal pro Jahr einen Aderlass über sich entgehen, um für eine Balance der Körpersäfte zu sorgen und damit ihre Gesundheit zu verbessern. Bei Badengästen in der Stadt Baden gehörte der Aderlass deshalb in der Regel zum medizinischen Programm. Ursprünglich waren die sogenannten «Bader» zuständig für medizinische Behandlungen vom Zähneziehen über das Schröpfen bis eben zum Aderlass. Sie betrieben Badestuben.
Bis im 19. Jahrhundert galt der Aderlass als regulärer medizinischer Eingriff, der Krankheiten bekämpfen und die Lebensqualität steigern sollte. Auch in Baden blieb Aderlass eine beliebte Therapie. Schliesslich kam man als Kurgast nach Baden, um gesund zu werden oder seine Lebenskraft zu stärken. Gäste badeten deshalb regelmässig im heilenden Thermalwasser und liessen weitere Therapien wie Aderlass über sich entgehen.
Noch heute gibt es Kliniken und Krankenhäuser, welche Aderlass in ihrem medizinischen Angebot haben, um beispielsweise den Kreislauf zu entlasten. Die Anwendung gilt aber als alternative Heilmethode und wird von den meisten Krankenhäusern nicht mehr durchgeführt. Denn man weiss mittlerweile auch, dass der Apparat oft mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet.
Bahnhofsglocke (1847)

Die Bahnhofsglocke von 1847 ist nicht nur ein funktionales Objekt, sondern auch ein Symbol der Verbindung zwischen Menschen und Städten der Schweiz im 19. Jahrhundert. Sie erinnert an eine Zeit, in der die Eisenbahn eine bedeutende Rolle im Transportwesen und dem Tourismus spielte, denn ihr Läuten war sowohl für Reisende in Baden als auch für das Bahnhofspersonal ein vertrautes Zeichen für die Abfahrt und die Ankunft von Zügen der Schweizerischen Nordbahn, besser bekannt als Spanisch-Brötli-Bahn.
Der Name geht auf die berühmten Spanisch-Brötli zurück, welche im 16. Jahrhundert vom Herzogtum Mailand über Süddeutschland nach Baden kamen. Baden war damals als Tagsatzungsort der Eidgenossenschaft ein wichtiger politischer Ort. In Baden wurden also die sogenannten Spanisch-Brötli hergestellt und schon bald per Eisenbahn nach Zürich gebracht.
Am 9. August 1847 begann die erste Eisenbahnlinie der Schweiz Gäste von Zürich nach Baden und zurückzubefördern. Vier Züge verkehrten pro Richtung für jeweils CHF 1.60 in der ersten Klasse, CHF 1.20 in der zweiten Klasse und CHF 0.80 in der dritten Klasse. Die Reise war sofort sehr beliebt: In der ersten Woche fuhren 9025 Personen mit der Spanisch-Brötli-Bahn.
Schon bald wurde das Schienennetz erweitert. Von Baden aus konnte man bequem mit dem Zug nach Brugg, Aarau, Winterthur, Schaffhausen, Turgi und sogar Waldshut reisen. 1853 wurde die Spanisch-Brötli-Bahn schliesslich von Alfred Escher in die Nordostbahn integriert, welche 1902 Teil der SBB wurde.
Baden war also ein frühes Zentrum der Eisenbahngeschichte und die Spanisch-Brötli-Bahn sowohl für den Tourismus als auch für den Warentransport von bzw. nach Baden von grosser Bedeutung. Anstatt mit einer Pferdekutsche zu fahren, wo die Pferde Nahrung und Pausen benötigten, und die Kutsche holperte und langsam vorwärts kam, konnte man nun billiger und vor allem schneller reisen. 45 Minuten dauerte die Fahrt zwischen Baden und Zürich mit dem Zug, mit der Postkutsche hingegen 5 Stunden! Die Bahn bot auch die Möglichkeit, viele Passagiere und Waren gleichzeitig zu transportieren. Dadurch unterstützte sie auch die Industrialisierung Badens.
Für den Kurort Baden war besonders wichtig, dass Gäste mit der Eisenbahn anreisen konnten. Im späten 19. Jahrhundert wurde Baden auch dank der exzellenten Zugverbindungen ein beliebtes Reiseziel für Kurgäste aus dem Adel und Bürgertum, die eine Auszeit von Stress und Verpflichtungen suchten, von Krankheiten geplagt waren, oder einfach in Baden einen Luxusaufenthalt geniessen wollten.
Der Badener Bahnhof als Knotenpunkt für die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung der Stadt - ohne Bahnhofsglocke wäre das nicht möglich gewesen. Denn mit der Eisenbahn kam auch die Standardisierung der Zeit. Züge mussten ihre Fahrpläne einhalten, und dafür war es unabdingbar, dass überall die gleiche Zeit galt.
Die Bahnhofsglocke von 1847 wurde von Jakob Keller, einem renommierten Glockengiesser aus Unterstrass, für die schweizerische Nordbahn gegossen. Jahrzehnte vergingen, und die Glocke schien unauffällig im Rhythmus der Zeit zu läuten, während die Menschen tagtäglich an ihr vorbeigingen.
Jedoch verschwand sie auf einmal inmitten des Wirbels der Geschichte, um schliesslich Jahre später anonym dem Historischen Museum Baden überreicht zu werden. Es ist bis heute nicht bekannt, wer die Glocke dorthin gebracht hat.
Sie steht jetzt auf einem weissen Sockel in der Dauerausstellung des Historischen Museums und kann dort von Menschen besucht werden, die sich für die Eisenbahngeschichte und die Geschichte Badens allgemein interessieren.
Insgesamt zeigt die Geschichte der Bahnhofsglocke und der Spanisch-Brötli-Bahn die wichtige Rolle, welche die Eisenbahn in der Schweiz gespielt hat. Von der Expansion des Schienennetzes bis hin zur Förderung des Tourismus und des Warentransportes, hat die Bahn einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Landes geleistet. Die Bahnhofsglocke ist deshalb ein Symbol für die Verbindung zwischen Menschen, Städten und der Schweiz im 19. Jahrhundert.
Bericht der Badarmen-Commission über die Armen-Badanstalt (1860)
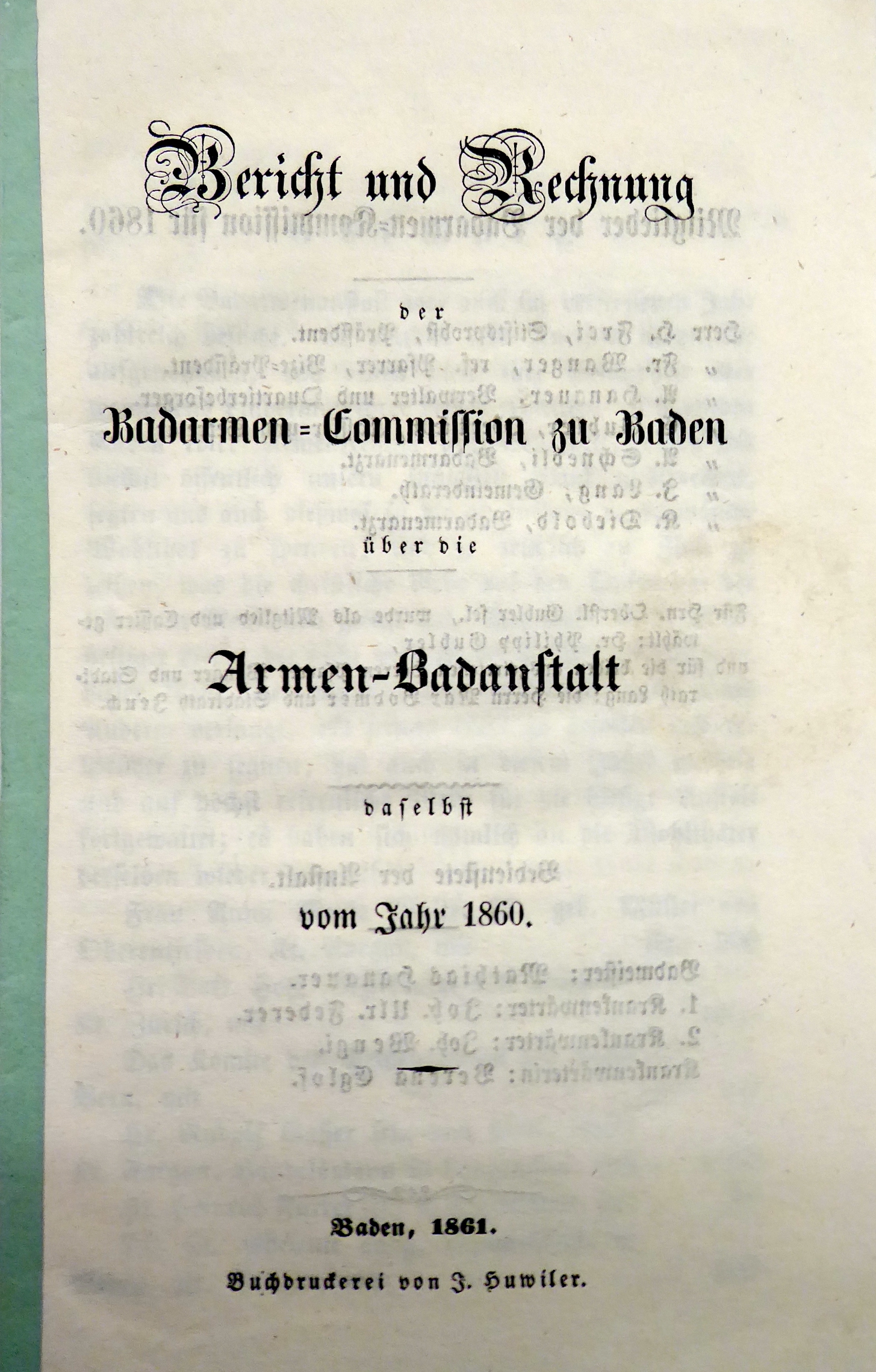
Unter den Quellen des Badener Stadtarchivs ist ein Jahresrückblick der Badarmen-Kommission von 1860, welcher uns gleich angesprochen hat. Uns hat interessiert, wie die Bäder damals benutzt wurden und welche Rolle die Hygiene gespielt hat.
Die Badener Bäder waren ein bedeutender Teil der grossen Bäderkultur, die bereits von den Römern geschaffen wurde. Im 19. Jahrhundert erhofften sich die Besucher der Badener Bäder, dass sie der Aufenthalt im Wasser von diversen körperlichen Beschwerden heilt.
Ein Aufenthalt im Kurort Baden war teuer, und nicht alle konnten sich so etwas leisten. Arme Leute konnten deshalb für wenig Geld eine Armenbadeanstalt besuchen, die hauptsächlich mit Spenden finanziert wurde. 1859 verzeichnete das Armenbad 385 Besucher, hauptsächlich Schweizer aber auch Franzosen, Deutsche und Österreicher. Sie bekamen für «täglich acht Batzen» Zugang zum Bad und ärztlicher Versorgung.
Trotz der vielen Ähnlichkeiten kann man Baden als Badekurort im 19. Jahrhundert nicht mit einem heutigen Wellnesshotel vergleichen, da man für die Bäder eine ärztliche Bescheinigung benötigte. Der Bericht der Armenbadkommission zeigt, dass in der Armenbadeanstalt mindestens ein Arzt sowie mehre Krankenpfleger und Krankenwärter anwesend waren. Aufgrund des medizinischen Personals und der strengen Verhaltens- und Hygienevorschriften, die vom Rat der Armenbadkommission festgelegt wurden, glichen die Armenbäder viel mehr einer aktuellen medizinischen Einrichtung als einem Freizeitbad.
1859 litten die meisten Patienten des Armenbades an Rheuma, aber es gab auch zahlreiche Fälle von Arthritis, Ischias, Tuberkulose, Lähmungserscheinungen nach Hirnschlägen und Bandscheibenvorfällen, Versteifung, Arthrose, und Wirbelsäulenbeschwerden, chronische Lungenleiden und sogar Personen mit Ekzemen und Hautgeschwüren. Sie alle erhofften sich durch das Bad eine Verbesserung oder sogar eine vollständige Genesung. Das scheint für viele möglich gewesen zu sein: Knapp die Hälfte der Patienten gab an 1859, dass sich durch den Aufenthalt eine «wesentliche Besserung» ergeben hatte. Nur bei gerade 31 gab es keine Verbesserung.
Wir interessierten uns speziell für die Hygienemassnahmen der Badener Bäder und der Bericht war für uns von grosser Bedeutung, weil er auch die Finanzen und Veränderung in der Armenbadkommission behandelte. Anhand von den Ausgaben erhielten wir wichtige Informationen über die damalige Hygienemassnahmen und konnten wichtige Unterschiede zwischen den Massnahmen des 19. Jh. und des 21. Jh. erkennen.
Von Infektionskrankheiten betroffene Personen wurden nicht in die Bäder zugelassen. In den Bädern herrschten Verhaltensregeln wie zum Beispiel das Abduschen vor dem Betreten des Bades oder das Verbot von Essen und Trinken im Bad. Auch die Krankenwärter hatten den Auftrag die Hygienevorkehrungen zu unterstützen und ein Abwart war für das Putzen der Bäder zuständig. Noch ein letzter Faktor waren die externen Firmen, die mit dem Waschen der Bademäntel und anderen Badeutensilien beauftragt waren, und für welche die Badarmenkommission grosse Geldsummen ausgab. Jedoch existierte ein grosses Problem: Das Thermalwasser wurde in gewissen Bädern nur einmal wöchentlich erneuert, so dass das Wasser in keiner Weise mehr den hygienischen Anforderungen eines sauberen Wassers entsprach.
Fahrrad (1864)

Die Pandemie hat dem Fahrrad grossen Aufschwung gegeben. Doch wie sah es früher aus? Das haben wir uns gefragt, als wir ein Männerfahrrad von 1864 als unser Objekt gewählt haben.
Rahmen, Lenker und Speichen unseres Velozipeds sind aus Metall gefertigt worden. Die Griffe des Lenkers und die Innenseite der Räder sind aus Holz. Der Antrieb wurde durch den Pedalantrieb geleistet, welcher ohne Kette direkt am Vorderrad angebracht wurde. Pedalen waren um 1864 eine Sensation. Es gab verschiedene Erfinder, die für sich beanspruchten, in den 1860er Jahren Pedalen erfunden zu haben (Karl Kech 1862, Pierre Lallement 1864). Unser Fahrrad ist also ein sehr seltenes Objekt auf dem Höhepunkt der damaligen Technologie.
Da es keine Gänge gab, wurde das Fahrrad bei Steigungen hochgeschoben. Ein weiteres Merkmal ist, dass sich an der Vordergabel keine Feder befindet und die Räder durch das Holz und Metall auch nicht stossdämpfend sind. Deshalb hat man den Sattel vermutlich auch auf einem dünnen Metallteil befestigt, damit die Elastizität des Metalls die Schläge abfedert und das Fahrerlebnis sich so verbessert. Viel gebracht hat es aber wahrscheinlich nicht, denn Velozipede waren damals auch als «Knochenschüttler» bekannt. Sicherheitsaspekte wurden zu dieser Zeit offensichtlich noch nicht beachtet. Am Fahrrad findet man auch keine Art der Beleuchtung und auch keine Schutzbleche, was darauf schliessen lässt, dass man das Fahrrad eher bei schönem Wetter benutzt hat.
In den 1860er Jahren hatten nur sehr wenige Leute ein Veloziped, da ein solches Gefährt für die damalige Zeit sehr teuer war. Es war sehr aufwändig, ein solches Fahrrad herzustellen, da es in reiner Handarbeit gefertigt wurde. Für die Arbeiterklasse und den Mittelstand war der Erwerb eines Fahrrades ausser Reichweite. Die raren Fahrräder wurden also fast nur von Männern der Oberschicht benutzt. Zu dieser zählten damals in Baden Fabrik- und Firmenbesitzer, Hoteliers und erfolgreiche Restauranteure. Frauen konnten wegen ihren langen Röcken nicht auf Fahrrädern sitzen. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen manche Frauen, unter ihren Röcken Hosen zu tragen, damit sie Fahrradfahren konnten. Das wurde aber in der Öffentlichkeit nicht gerne gesehen, denn Hosen waren eigentlich Männersache.
In den 1860er Jahren benutzten Fahrradfahrer ihr Gefährt vor allem für Freizeitaktivitäten und um ihren Wohlstand der Aussenwelt zu präsentieren. Die Fahrräder waren nämlich bis zu etwa 30 Kilogramm schwer und somit für den Alltag eher ungeeignet. Ausserdem gab es in dieser Zeit eigentlich noch keine Autos. 1864 wurde zwar das erste Automobil mit einem Einzylinder entwickelt. Doch dieser Prototyp fuhr nur 500 Meter weit, von dem her hatten die Autos keinen Einfluss für die Entwicklung und Verbreitung des Fahrrads. Die Menschen in dieser Zeit benutzten eigentlich nur Kutsche, Zug oder Schiff, um lange Strecken zurückzulegen oder sie gingen zu Fuss. Um kurze Strecken nicht mehr zu Fuss zurücklegen zu müssen, schaffte man sich ein Fahrrad an, wenn man sich das leisten konnte.
Da der Preis eines solchen Fahrrades zu dieser Zeit ziemlich hoch war und es auch nicht viele wohlhabende Menschen gab, denken wir, dass man ein Fahrrad wie das unsere eher selten zu Gesicht bekam. Wir vermuten, dass das damalige Fahrrad mit den heutigen Sportwagen zu vergleichen ist. Das Fahrrad im Museum gehörte dem Hotelier Bruno Saft, der auch Direktor des Grand Hotels Baden von 1876 bis 1900 war. Das Grand Hotel war Badens teuerstes und grösstes Hotel mit viel internationaler Kundschaft. Saft war nicht nur reich, er hat sicher auch Wert darauf gelegt, wie er sich in der Öffentlichkeit zeigte und sich fortbewegte. Ein solches Fahrrad war damals ein Luxusobjekt gewesen, das für einen Hotelier wie Saft durchaus angemessen war.
Die Produktion des Fahrrades vereinfachte sich aber mit der Zeit und es konnten sich vermehrt Leute des Mittelstandes ein Fahrrad leisten und dadurch die Vorzüge der Mobilität geniessen.
Kleid im Rokoko-Stil (1880)

Zwischen den Jahren 1730 und 1760 herrschte in Europa die Blütezeit des «Rokoko». Kunstvolle und detaillierte Ornamente, bunte Pastellfarben, extravagante Kleidung und ländliche Gemälde sind alles Kennzeichen des Stils, der als Reaktion auf den düsteren Barock entstand.
In der Schweiz gewann der Rokoko-Stil um 1750 an Beliebtheit und hatte seinen Höhepunkt bis um 1780, besonders in der Ost- und Innenschweiz. Verschiedene Objekte und Ornamente waren in verschiedenen Teilen der Schweiz verbreitet. In der Nordschweiz war die Tafelmalerei verbreitet und in Zürich die gemalte Wandbespannung. Zürich begann schon früh am Stil zu zweifeln und schlussendlich wurde das Rokoko auch in der Schweiz vom Klassizismus abgelöst.
Auch Jahrhunderte später Rokoko noch so relevant, dass man immer noch Kleider in diesem Stil zum Beispiel als Kostümkleider oder auch als Alltagskleider herstellt. Auch unser Kleid wurde vom Rokoko inspiriert. Es wurde ca. 1880 hergestellt und ist aus schwarzer Seide. Mit seinem beschmückten, engen Oberteil und dem weiten Rock ist es ganz im Stil des Rokokos. Das Kleid weist jedoch nicht nur Ähnlichkeiten mit dem Stil des 18. Jahrhunderts auf, sondern auch mit den Trends des späten 19. Jahrhunderts.
Im Jahr 1880 gab es Modetrends, die im Gegensatz zum Rokoko standen. Ein gutes Beispiel davon sind die schlanken Silhouetten. Zur Zeit des Rokokos waren Kleider aufgebauscht und so breit wie möglich, aber unser Kleid eher schmal und betont die Figur. Auch die schwarze Farbe passt nicht zu den Pastellfarben des Rokoko.
Jedoch gibt es auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Zeiten. Wie im 18. Jahrhundert, so auch im späten 19. Jahrhundert, trugen Frauen Korsette, um eine möglichst kleine Taille zu erlangen. Auch unser Kleid besitzt ein eingebautes Korsett. Was auch ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den zwei Jahrhunderten darstellt, ist die starke Überdekoration der Kleidung. Spitzen, dekorative Rüschen, Perlmuttknöpfe, Tüll und Falten waren mehr als erwünscht. Obwohl diese Merkmale bei unserem Kleid nicht so offensichtlich sind, kann man bei näherem Betrachten Stickereien und Knöpfe erkennen, welche als Verzierung angebracht wurden.
Wer trug wohl dieses Kleid? Die genauere Herkunft ist leider nicht überliefert. Allerdings konnten sich um 1880 nur reiche Frauen ein Seidenkleid leisten. Weshalb trug wohl eine reiche Frau in Baden um 1880 ein Kleid im Rokoko-Stil? Es gibt verschiedene mögliche Erklärungen: Manche reiche Badener Familien orientierten sich an Trends, wie zum Beispiel dem Geschmack der BBC Besitzerfamilien, allen voran der Familie Brown. Und diese hatte eine Vorliebe für Rokoko. Es gab nämlich in ihrem Haus Rokoko-Möbel. Denkbar ist auch, dass ein Fest wie beispielsweise einen Maskenball stattfand, bei dem man sich zu einem bestimmten Thema kleidete, wie später bei den Themen der Badenfahrten.
Vielleicht gehörte das Kleid auch einfach einer Dame, die sich gerne in diesem Stil kleidete. Anlass dazu gab es durchaus. Im späten 19. Jahrhundert war Baden schliesslich ein beliebter Tourismusort. Die Bäder als Kurort, die alljährliche Badenfahrt mit ausgelassenen Festen und diverse Hotels als Vergnügungsort der Reichen zogen Gäste in Scharen an. 1876 feierte das Grand Hotel in Baden seine Eröffnung. Seine Gäste waren gutbetucht und kamen aus ganz Europa. In so einem Luxushotel kleidete man sich entsprechend. Baden wurdenicht nur für die Touristen herausgeputzt: Strassen und Parks erlaubten es auch Badenerinnen und Badener, zu flanieren und sich der Öffentlichkeit präsentieren. Ein Seidenkleid im Rokoko-Stil hätte sicher die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Auch wenn wir schlussendlich nicht wissen, wer genau wann und weshalb dieses Kleid getragen hat, so ist es doch ein Zeugnis der Badener Gesellschaft um 1880.
Maura, Nina, Rhea
Massregeln bei Choleragefahr (1884)
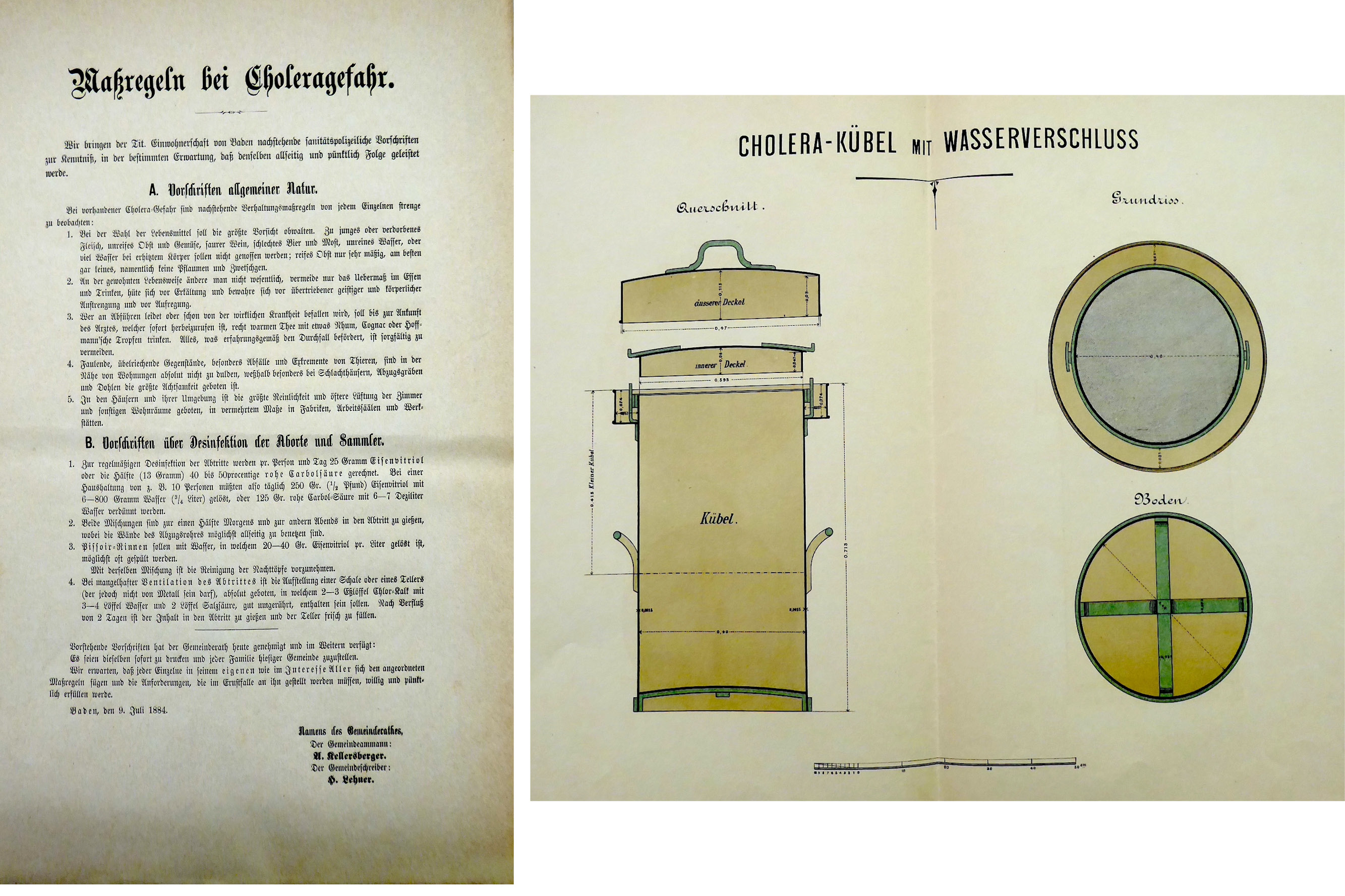
Cholera, ursprünglich in Asien beheimatet, gelangte 1831 erstmals nach Europa und suchte im Jahre 1854 die Schweiz heim. 1867 und 1885 kam es wieder zu Choleraepidemien, auch in Baden. Der Choleraerreger greift die Darmschleimhaut an, was starke Brechdurchfälle zur Folge hat und tödlich enden kann.
Wie haben die Choleraepidemien 1867 und 1885 die Stadt Baden beeinflusst? Zwei Archivdokumente des Stadtarchivs Baden können diese Frage beantworten.
Im Dokument «Die Cholerafälle im Bezirk Baden im Jahr 1867» werden zehn verschiedene Cholerafälle beschrieben. Die Dokumentation dieser Fälle wurde vom Bezirksarzt von Baden verfasst. Er hat darin vor allem vom Krankheitsverlauf der betroffenen Personen berichtet und versucht, die Verbreitung von Cholera festzuhalten.
Viele Kantone, auch Zürich, waren stark betroffen. Das Archivdokument von 1867 zeigt, dass die Krankheit von Zürich in den Bezirk Baden geschleppt wurde. Die Ansteckungen erfolgten nicht durch Besuche eines infizierten Hauses, sondern durch den Verbleib auf den Zürcher Strassen. Viele Bewohner des Bezirks Baden tätigten nämlich ihre Einkäufe in Zürich auf dem Markt. Bei diesem Aufenthalt steckten sie sich mit Cholera an und brachten das Bakterium so nach Baden. Im Bezirk Baden selbst kam es laut der Dokumentation zu keinen weiteren Ansteckungen, sie erfolgten alle in Zürich.
1884 gaben die Badener Behörden «Massregeln bei Choleragefahr» heraus. Sie enthielten zum Einen Vorschriften allgemeiner Natur, zum Anderen Vorschriften über Desinfektion der Aborte und Sammler. Zu den Vorschriften allgemeiner Natur gehörte die Wahl der Lebensmittel, wobei zum Beispiel nur sehr mässig Obst gegessen werden sollte, oder das regelmässige Lüften der Wohnräume.
Weil Cholera sich durch schlechte Hygiene und verunreinigtes Trinkwasser verbreitet, wurden auch massive Hygienemassnahmen eingeführt. Man begann die Häuser regelmässig zu desinfizieren und auszuräuchern. Der Badener Gemeinderat verlangte auch, dass die Abtritte, auch Klosetts genannt, mit Eisensulfat oder Karbolsäure gereinigt werden.
Auf einer Doppelseite des Dokuments ist ein Abtrittkübel abgebildet, welcher eine wichtige Rolle in der Geschichte des Abwassersystems spielt. Vor den Epidemien hatten die meisten Schweizer Haushalte nämlich einen Abtritt, welcher durch ein Fallrohr mit einem Ehgraben verbunden war. Die Fäkalien fielen also durch dieses Fallrohr in den offenen Kanalisationsgraben und wurden dort liegen gelassen. Das war bereits sehr unhygienisch. Dazu kam, dass das schmutzige Wasser in diesen Gräben abfloss und in offenen Gewässern landete. Das Trinkwasser wurde hauptsächlich aus diesen Gewässern bezogen, wodurch es mit Fäkalien und darin enthaltenen Krankheitserregern verunreinigt wurde. Auch in Baden wurde dies zum Problem, da das Trinkwasser aus dem Stadtbach stammte.
Da Cholera überwiegend durch dieses verunreinigte Trinkwasser verbreitet wurde, musste dringend eine Lösung her. Man war gezwungen, das Abwassersystem zu überdenken. Deshalb forderte man in Zürich 1867 eine Kloakenreform. Man entschied sich, ein Kübelsystem nach Pariser Vorbild einzuführen. Damit wurde die offene Kanalisation zu einer geschlossenen weiterentwickelt. Dieser Kübel, welcher im Archivdokument dargestellt ist, trennte feste von flüssigen Fäkalstoffen. Die Exkremente fielen durch ein Fallrohr in den Kübel, welcher durch ein Sieb in zwei Abschnitte unterteilt wurde. Die Flüssigkeiten konnten dann durch das Sieb in die Kanalisation ablaufen, während der Kübel mit den festen Stoffen regelmässig geleert wurde.
Auch in der Stadt Baden wurde nach einer Lösung gefragt, da das bestehende System der Wasserversorgung den Anforderungen nicht mehr genügte. 1881 kam es also zu einem Ausbau des Abwassersystems. Die Abbildung im Archivdokument zeigt, dass auch Baden solche Cholerakübel eingesetzt hatte.
Qilin (späte Qing-Dynastie)

Einhörner? Natürlich kennt jeder das europäische Einhorn, das in unzähligen Kinderbüchern, Filmen und Mythen vorkommt. Das chinesische Einhorn dagegen, auch Qilin genannt, kennt fast keiner. Das Qilin-Paar, welches wir untersucht haben, stammt dem Museum Langmatt und ist ein Fabelwesen aus der chinesischen Mythologie, ein Glücksbringer und ein Beschützer, dass man heute noch vor Eingangstüren, als Statuen oder als Amulette antrifft.
Hinter diesem Mischwesen steckt mehr, als man denkt, denn diese Porzellanfigur hat eine faszinierende Reise hinter sich, die uns nicht nur einen Einblick in die chinesische Mythologie, sondern auch in das Leben in Baden gibt.
Das Qilin ist eine fabelhafte Kreatur mit Hufen, einem drachenartig geschuppten Pferdekörper und einem einzelnen Horn auf dem Kopf. Da es in der Mythologie selten erscheint, variiert seine Darstellungen stark. Manchmal ähnelt es einer Giraffe mit zwei Hörnern, einem langen Hals und Hufen. Es ist möglich, dass Reisende von diesen Tieren in Nordafrika berichteten oder diese sogar mitbrachten.
Qilin kommen meistens paarweise vor, man sieht sie fast nie allein, was auf das Yin-Yang-Prinzip zurückzuführen ist. Denn Yin und Yang bilden in der chinesischen Mythologie die Grundlage des Universums. Sie sind das Prinzip des untrennbaren perfekten Gegensatzpaares, bei dem die weibliche Eigenschaft „Yin“ allen Dingen ihre Form verleiht und die männliche Eigenschaft „Yang“ sie mit Geist füllt. Auch unsere Figur ist Teil eines Paares, das im Langmatt ausgestellt ist.
In der chinesischen Mythologie bedeutete das Auftauchen von Qilin immer etwas Gutes. Sie erschienen oft, wenn wichtige Personen geboren wurden oder ein neuer Herrscher die Macht übernahm. Noch heute werden Qilin als Glücksbringer angesehen, die Güte und Wohlwollen verkörpern. Sie sollen mit ihrem exotischen Aussehen böse Geister abwehren.
Qilin kommen nicht nur auf Gemälden vor, es gibt sie auch als Porzellanfiguren und steinerne Statuen. Manche dieser Figuren sind mit der Chinoiserie nach Europa gelangt, so auch unser Qilin-Paar im Langmatt.
Während der Epoche der Chinoiserie (17.-19. Jh.), war Europa fasziniert von chinesischen Motiven und Designs. Das ist der Grund, weshalb wir heute so viele chinesisch abgeleitete Kunst in Europa haben und auch (pseudo-)chinesische Möbel und Geschirr. Die Chinoiserie spiegelte sich in der (Innen-)Dekoration von Häusern der Oberschicht wider und prägte die europäische Kunstlandschaft massgeblich. In der Schweiz war sie besonders in den deutschsprachigen Regionen beliebt und viele reiche Familien hatten ein Chinazimmer mit Tapeten und Möbeln.
Während sich die meisten Familien nur Möbel leisten konnten, die chinesische aussahen aber in Europa hergestellt wurden, war das bei der Familie Brown nicht der Fall. 1896 heirateten Sidney Brown und Jenny Sulzer und bauten kurz darauf die Villa Langmatt neben dem Fabrikgelände der BBC. Beiden waren sehr interessiert an Kunst und kauften besonders in Deutschland und in Frankreich viele Kunstwerke. In den 1920er Jahren legten sie den Schwerpunkt auf Kunst aus Frankreich und waren dazu mit verschiedenen Kunsthändlern in Kontakt. So scheinen sie auch das Qilin Paar gekauft zu haben. Im Gegensatz zu anderen Herrschaftshäusern gab es in der Villa Langmatt zwar kein Chinazimmer, doch mit den Qilin doch noch ein bisschen Chinoiserie.
Das Qilin hat uns von den alten Legenden der chinesischen Mythologie bis hin zur europäischen Kunstgeschichte begleitet und konnte uns Einblicke in das Leben in Baden im 17. und 18. Jahrhundert geben. Wir haben gelernt, dass diese faszinierende Kreatur nicht nur ein Symbol für Glück und Schutz ist, sondern uns auch auf die kulturelle Verbundenheit zwischen China und Europa durch die Chinoiserie aufmerksam macht.
Denn ihre Reise hat uns gezeigt, wie Kunst und Kultur die Grenzen überschreiten und Menschen auf der ganzen Welt verbinden können und eine Erinnerung daran ist, dass hinter einem Objekt oft viel mehr steckt, als man auf den ersten Blick vermutet.
Damenhut (1880–1920)

Der Damenhut; ein Statussymbol
Der Damenhut aus dem Historischen Museum Baden ist ein Hut wie kein anderer. Wir hatten viele Probleme, unseren Hut einem Stil zuzuordnen, nirgends fanden wir einen ähnlichen Hut. Wie und von wem wurde er hergestellt? Wer trug ihn? Und was sagt er über die damalige Gesellschaft aus?
Auf den ersten Blick kann man unschwer erkennen, dass dieser Hut, der um 1900 hergestellt wurde, sehr schön und edel aussieht. Er ähnelt von der Form her einem Glockenhut ohne Rand und ist mit einem schwarzen, samtartigen Stoff überzogen. Eine zweite Stoffschicht wurde um den Hut herumgewickelt. Er besitzt eine dunkelblaue Farbe, welche wegen der Glätte des Stoffes ein wenig schimmert. Auf der Vorderseite ist mit einem dunkelblauen Band ein rundes, altgoldfarbiges Ornament angebracht. Das Ornament ist aus Messing und mit Schmuckperlen besetzt. Messing wurde um 1900 oft benutzt, um goldig-glänzende Produkte herzustellen. Auch ziert eine dünne Netzmaske mit kleinen Filzkügelchen die Vorderseite des Hutes. Schwarz und weisse Straussenfedern auf der linken Seite wirken elegant. Eines ist klar: Wer diesen Hut trug, wollte auffallen.
Um 1900 waren die Schweizer Mode und somit auch die Badener Mode der Oberschicht stark von europäischen Modetrends. Diese wiederum wurden durch politische und kulturelle Veränderungen beeinflusst. Ende des 19. Jahrhunderts war die Zeit der grossen Kolonialreiche. Neue Produkte kamen von den Kolonien nach Europa, und wer sie besass, konnte zeigen, dass er oder sie reich war.
Obwohl die Schweiz keine Kolonien besass, nahm auch dort das Interesse an fremden Ländern auf. Exotische Produkte und die damit verbundenen Völkerschauen waren sehr beliebt. Das hatte auch Auswirkungen auf die Schweizer Mode: So tauchten vermehrt Federn in der Kleidung der Leute auf, denn durch den Handel mit den Kolonialgebieten war es möglich, an Federn von exotischen Vögeln wie zum Beispiel Straussen zu gelangen. Der Run auf Federn für Hüte war so gross, dass ganze Vogelarten ausgerottet wurden. Gewisse Federn waren das zweifache ihres Gewichtes in Gold wert.
Straussenfedern auf Hüten kamen hauptsächlich von Straussenfarmen in Südafrika. Dort waren Straussenfedern neben Gold, Diamanten und Wolle das wichtigste Exportgut. Sie wurden eingefärbt und zusammengenäht und von London aus in die ganze Welt verkauft.
Ein Hut mit seltenen Vogelfedern war ein Statussymbol wie heute eine Rolex. Eine modern gekleidete Frau ging nur mit Hut auf die Strasse. Er gehörte zum guten Ton. Reiche Verzierungen durch teure Schmuckstücke, Spitze und eben exotische Vogelfedern waren modern und symbolisierten den Wohlstand der Damen.
Ein Hut mit Straussenfedern wie der unsere war ganz klar ein Luxusobjekt, das sich eine Badener Frau, die in einer Fabrik arbeitete, nicht leisten konnte. Das müsste schon eine Frau aus dem Bürgertum gewesen sein, vielleicht aus einer der Familien von Hotelbesitzern oder Industriellen. Zudem gab es in Baden um die Jahrhundertwende auch viele Touristinnen, welche in den teuren Hotels ein- und ausgingen. Diese trugen entsprechend schicke Kleidung und Hüte.
Die schnelllebige Hutmode brachte Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder neue Trends mit sich. Hüte wurden von Hutmachern hergestellt. Durch die Industrialisierung verlor ihr Beruf an Bedeutung, da man einfache Alltagshüte nun in Fabriken herstellen konnte und sie so für mehr Leute zur Verfügung standen. Um zu überleben, mussten die Hutmacher auf die Oberschicht setzten und stellten so vermehrt kunstvolle Hüte mit vielen Verzierungen her. Die Hüte der Frauen waren nun fantasievoll, dramatisch, geschmückt und wurden von ihren Trägerinnen meist schräg auf dem Kopf aufgesetzt.
Auch auf Anlässen wie Hochzeiten und anderen Festen durften Hüte natürlich nicht fehlen. Kombiniert wurden sie oft mit einem eleganten, langen Kleid, welches bis zum Boden reichte. Wir wissen nicht genau, von wem und zu welchen Anlässen unser Hut getragen wurde, aber stolz war seine Besitzerin auf ihn mit Sicherheit.
Telefon (1900–1910)

Alexander Graham Bell hat 1876 das erste Mal ein von ihm entwickeltes elektromagnetisches Telefon getestet. Zwei Jahre später entwickelte Lars Magnus Ericsson ein Telefon, das er nach sich selbst benannte: Das «L.M. Ericsson». Wir haben ein solches Telefon aus der Sammlung des Historischen Museums Baden ausgewählt und versucht, über die Geschichte des Telefons in Baden um 1900 mehr zu erfahren.
Nur vier Jahre nach der Erfindung des Telefons wurde 1880 in Zürich die erste Telefonzentrale der Schweiz eröffnet. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes wurden immer mehr Telefonzentralen gebaut. Schon 1883 gab es die erste Fernverbindung von Baden nach Zürich und zwei Jahre später eine Telefonzentrale in Baden.
1885 gab es zwar in Baden bereits eine Telefonlinie, aber Telefongespräche wurden in diesem Jahr noch keine geführt. Badener und Badenerinnen, die mit anderen Personen kommunizieren wollten, musste Briefe schreiben oder Telegramme schicken. Telegramme waren teuer, aber Baden als Tourismusort und Industriezentrum war reich: 1885 wurden in Baden satte 21’250 Telegramme verschickt!
Auf Postkarten der Vorstadt Badens, die um die Jahrhundertwende hergestellt wurden, kann man bereits Telefonmasten feststellen. Unser Telefonmodell, das L.M. Ericsson war in der Schweiz erst ab 1905 erhältlich. In diesem Jahr gab es bereits 316 Teilnehmer in Baden, welche total 283'708 Telefongespräche in einem Jahr führten!
Baden als Kurort lebte vom Tourismus. Die Möglichkeit, per Telefon zu kommunizieren, war sehr wichtig für die Badener Hotels und Badeanlagen. Firmen wie Brown Boveri & Cie., die verschiedenen Betriebe, die zur Textilindustrie gehörten, oder auch die Biscuitsfabrik A. Schnebli & Söhne konnten mit dem Telefon Geschäfte abschliessen oder dringende Handelsinformationen mitteilen.
Bei den Privathaushalten sah es allerdings anders aus: Nur die allerwenigsten Badener und Badenerinnen besassen um 1900 ein Telefon. Dieses war auch nicht zu vergleichen mit dem heutigen Mobiltelefon, das in der Tasche getragen wird. Das L.M. Ericsson stand zu Hause auf einem Tisch oder Schrank und es wurden nur von wohlhabenderen Menschen genutzt. Es kostete nämlich ca. 65 Franken, einen enormen Betrag für die damalige Zeit. Zum Vergleich: Ein Fabrikarbeiter verdiente damals 20-30 Rappen pro Stunde.
Auch bei reichen Familien wurde anfangs wahrscheinlich noch nicht oft telefoniert, denn wenn man zum Beispiel ein Familienmitglied oder Bekannten anrufen wollte, war die Wahrscheinlichkeit tief, dass die Person, welche man erreichen wollte, auch ein Telefon besass. Dies änderte sich jedoch schnell. Das Telefon wurde so beliebt in Baden, dass man in den 1920er Jahren mit der 1919 eingerichteten Telefonzentrale von 800 Teilnehmern nicht mehr auskam. 1931 wurde deshalb zwischen der Bahn und der Parkstrasse ein neues Postgebäude eröffnet, das auch ein Telefongebäude war. Das neue Telefonamt war für 1’800 Abonnenten eingerichtet, die bis auf 3'000 Anschlüsse ausgebaut werden konnten.
Die Verbreitung des Telefons führte auch zu neuen Jobs in Baden: Neben Mechanikern und Elektrikern waren vor allem auch Telefonistinnen gefragt, die im neuen Gebäude eigens eine Teeküche bekamen.
Wir wissen nicht, wer das L.M. Ericsson aus dem Historischen Museum in Baden besass. Vielleicht war es ein Hotel, vielleicht die BBC oder eine der wohlhabenden Familien der zahlreichen Fabrik- oder Hotelbesitzer in und um Baden.
Wahlurne (1905)
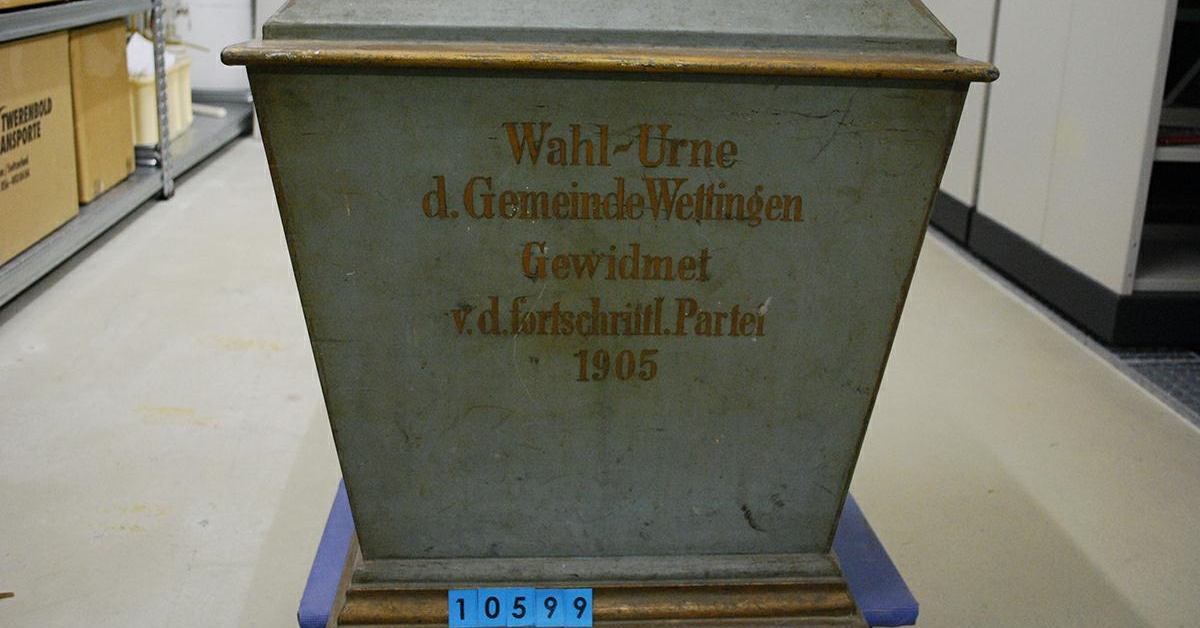
Was hat ein Name einer Partei auf einer Wahlurne zu suchen? Ist so eine neutrale Abstimmung überhaupt noch möglich? Und was hat es mit der «fortschrittlichen Partei» am Hut und was ist ihre Geschichte? Diese Fragen haben wir uns gestellt, als wir im Februar dieser mysteriösen, grünen Wahlurne im Historischen Museum Baden gegenüberstanden. Wir wollten wissen, wer und was dahintersteckt und, obwohl wir am Anfang befürchteten, dass wir nicht viel Spannendes über sie herausfinden würden, wurde uns nach einigen Recherchen schnell klar, diese Wahlurne ist mehr als nur ein Behälter.
“Wahlurne d. Gemeinde Wettingen, Gewidmet v.d fortschrittl.Partei 1905’’
Dieser goldene Schriftzug ziert die grün-blaue, hüfthohe, rechteckige Urne, in welche die Bewohner des Bezirks Baden und Wettingen ihre Stimmzettel 1905 reinwarfen. Sie ist in erstaunlich gutem Zustand und hat nur einige Kratzer und Abblätterungen der Farbe an wenigen Stellen.
Durch Recherchen haben wir herausgefunden, dass die FDP, also die freisinnig demokratische Partei, früher die fortschrittliche Partei war und somit auch die Stifterin der Urne. Sie kämpfte seit ihrer Gründung für den Wirtschaftsliberalismus und möglichst wenig staatliche Intervention. Mit ihrem relativ neuen Denkansatz galt sie deshalb 1905 auch als fortschrittlich. Auch in Wettingen stiess sie auf viel Zustimmung. Davor fiel die Wahl entweder auf die BGB (Vorläufer der SVP) oder die SP. Es gab keine Partei, die sich auf die freie Wirtschaft fokussierte. Im Jahre 1905 gab es die FDP erst elf Jahre lang. Trotzdem erfreute sie sich bereits grosser Beliebtheit in der Schweizer Bevölkerung und dominierte die Wahlen. Der Hauptgrund bestand wohl darin, dass sie so viele verschiedene Meinungen zusammenführte und sich vor allem Bauern und einfache Arbeiter, die einen Grossteil der Bevölkerung ausmachten, mit ihr identifizierten. Nach dem Ersten Weltkrieg fielen die Wahlergebnisse jedoch erstmals negativ aus. Durch eine Änderung des Wahlsystems verlor die FDP viele Sitze und ein Grossteil der Wählerschaft wechselte zur SVP und zur SP.
Die Wahlen liefen 1905 anders ab als heutzutage. Einerseits durfte nur ein ausgewählter Teil der Bevölkerung wählen gehen. Bürger unter 18 Jahren, Frauen, Geisteskranke, Verurteilte und weitere Gruppen wurden ausgeschlossen. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 24%, was für damalige Zeiten jedoch ein hoher Anteil war.
Andererseits musste man seinen Stimmzettel auch eigenhändig im Wahllokal ausfüllen und zusammen mit seiner Ausweiskarte in die Wahlurne legen. Dies war allerdings schon ein Fortschritt. Vor diesem System mussten die Menschen an grosse Versammlungen gehen und durch Handerheben abstimmen. Dies war für einen Grossteil der Menschen zu umständlich. Durch die Einführung der Blindwahlen, also den Wahlurnen, nahm die Wahlbeteiligung stark zu. Diese Neuerung wurde 1904 eingeführt, kurz vor dem «Geburtsdatum» unserer Wahlurne. Das System der Blindwahl war noch relativ neu und da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Regulierungen gab, was die Inschriften betraf, durfte die FDP auch die Urne stiften. Dabei beeinflusste die Inschrift auf unserer Wahlurne die Wahlen wohl nicht gross. Die meisten Leute hatten ihre Entscheidungen schon getroffen, bevor sie überhaupt das Wahllokal betraten. Theoretisch dürfte man sogar heute noch eine gestiftete Wahlurne aufstellen, jedoch würde das wohl keine Gemeinde mehr machen.
Andri, Mia, Sophie, Yannik
Nähmaschine (1905–1925)

Wir haben als Objekt für unsere Arbeit eine Tisch-Nähmaschine der Marke Pfaff aus dem Museum ausgewählt. Sie wurde zwischen 1905 und 1925 in Deutschland produziert. Die Nähmaschine hatte grosse Auswirkungen auf die Herstellung von Kleidern und Modetrends, auch in Baden.
Vor der Nähmaschine mussten Textilien von Hand genäht werden, was sehr aufwändig und teuer war. Bevor im 20. Jahrhundert Kleidung in Textilfabriken als Massenware hergestellt wurde, nähten die meisten Frauen ihre Kleider selbst und flickten sie auch. Sie konnten nämlich keine Massanfertigung in einer Schneiderei bezahlen.
Mit der Bevölkerungszunahme wurden aber immer mehr Kleider benötigt. 1790 erfand deshalb der Engländer Thomas Saint eine Maschine, bei der eine Ahle ein Loch in Leder stanzte und eine Nadel durch das Loch führte. Weitere Erfindungen folgten, bis 1845 Elias Howe eine Nähmaschine baute, die schneller nähen konnte als vier bis sechs Näherinnen zusammen. 1851 kopierte Isaac Merritt Singer den Steppstich von Howes Maschine und begann, Nähmaschinen zu verkaufen. In der Folge wurde Singer zum führenden Hersteller von Nähmaschinen. Der Deutsche Georg Michael Pfaff baute die Singer Maschine in seiner eigenen Firma nach. Die Pfaff Nähmaschine aus dem Historischen Museum Baden ist deshalb sehr ähnlich wie die damaligen Singer Nähmaschinen. 1910 hatte die Firma Pfaff bereits eine Million Nähmaschinen produziert. Das zeigt, wie wichtig Nähmaschinen damals für die Herstellung von Kleidung waren.
Nähen wurde als Sache der Frau angesehen. Mädchen hatten in der Schule Handarbeit als Fach und lernten dort Nähen und Flicken. Auch die Nähmaschinen wurden anfänglich besonders von Frauen benutzt. Die Pfaff-Nähmaschine aus dem Museum war damals sehr teuer, weshalb sie wahrscheinlich einer Hausfrau aus einer wohlhabenden Familie gehörte.
Mit der Nähmaschine konnten mehr Kleidungsstücke innert kürzerer Zeit angefertigt werden. Immer mehr Leute konnten nun ihre Kleidung kaufen, weil diese wegen der Nähmaschine billiger geworden war. So wurde es nun auch für Badener Frauen aus der (unteren) Mittelschicht und sogar für Arbeiterinnen möglich, Modetrends zu folgen. Je nach Einkommen sahen diese Trends aber unterschiedlich aus (Schnitt, Farben, Material). Besonders Frauen der Unterschicht hatten vor der Nähmaschine ihre Kleidung getragen, bis sie auseinanderfiel oder nicht mehr passte. Jetzt konnten auch sie immer wieder neue Kleider kaufen. Durch die Erfindung der Nähmaschine wurde das Nähen der Badener Alltagsmode also schneller und billiger, und auch die Auswahl Kleidungsstücken vergrösserte sich. Die Nähmaschine könnte also als Anfang von «Fast Fashion» bezeichnet werden.
Früher galt Baden als das industrielle Zentrum von Aargau, auch zum Dank der Textilindustrie. Durch die Industrialisierung entstanden mehrere Textilfabriken und es wurden auch Luxuskleidungsstücke hergestellt, beispielsweise nähte man für Frauen Spitzenschals. Viele Betriebe stellten Frauen als Näherinnen ein. Für viele Frauen war die Arbeit mit der Nähmaschine neben ihrem Haushalt eine grosse Belastung aber notwendig, um zusätzliches Einkommen für die Familie zu sichern.
Der Umgang mit der Nähmaschine war aber nicht ohne Probleme und die Näherinnen mussten lernen, wie sie Nähmaschine einsetzen konnten. Wenn man mit der Nähmaschine beim Nähen Fehler machte, wurde die Produktion dadurch aufgehalten. Manchmal waren die Fehler so gross, dass man die Textilien nicht mehr nutzen konnte, beziehungsweise nur für andere Textilien verwenden konnte. Auch konnte die Nadeln der Nähmaschine bei zu dicken Stoffen abbrechen. Es brauchte also Übung, bis man die Nähmaschine korrekt einsetzen konnte. Deshalb wurden Mädchen auch in sogenannten Industrieschulen im Nähen und anderen handwerklichen Tätigkeiten ausgebildet.
Die Nähmaschine hat sich zwar über die Jahre weiterentwickelt, doch ihre Wichtigkeit hat sie nie verloren. Noch heute wird sie sehr viel genutzt und sie ist in fast jedem Haushalt zu finden.
Feuerwehrhelm (1910)

Die Feuerwehr rettet, schützt und löscht. Von der Katze, die vom Baum gerettet werden muss, über die Hilfe bei Verkehrsunfällen bis hin zu den klassischen Bränden – die Feuerwehr hat ein unglaublich breites Einsatzgebiet. Für das Twistory-Projekt haben wir uns einen Feuerwehrhelm aus dem Historischen Museum Baden ausgesucht.
Als wir den Helm mit seinen goldenen Verzierungen betrachteten, hatten wir schon viele Fragen zur Herkunft des Helms und zu seinem Beitrag in der Badener Gesellschaft. Der Feuerwehrhelm wurde dem Historischen Museum Baden von Josef Deuschle-Labhards Enkel Hugo Doppler übergeben. Am 13. Juli 2021 wurde der Helm in das Sammlungsgremium aufgenommen.
Der Feuerwehrhelm stammt aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert. Er besteht hauptsächlich aus Metall und Leder. In der Mitte des Helmes ist das Badener Stadtwappen zu sehen, welches mit goldenen Ornamenten umrahmt ist. Auf der Spitze des schwarzen Helmes thront ein goldener Kamm und an der Seite befinden sich braune, abgenutzte Lederriemen, mit denen der Helm auf dem Kopf befestigt wurde. Das Innenfutter besteht ebenfalls aus Leder. Auf dem Foto nicht zu erkennen, ist die grüne Unterseite der Krempe.
Der Helm gehörte dem ehemaligen Kommandanten der städtischen Feuerwehr Josef Deuschle-Labhard, der von 1898 bis 1930 bei der Feuerwehr Baden tätig war. Der Helm stammt vermutlich aus dem Jahr 1910. Damals war es für die Feuerwehrleute üblich stabile Helme aus Stahl zu tragen; erst später tauschte man diese gegen leichte Integralhelme aus.
Josef Deuschle-Labhard war bereits ein langjähriges Mitglied der Badener Feuerwehr, als er 1907 zum Kommandanten ernannt wurde. Deuschle-Labhard brannte für die Feuerwehr und unterstützte sie in allen Belangen. In seiner Funktion als Stadtrat Badens förderte er die Ausbildung der Feuerwehrleute. Er gründete den aargauischen Feuerwehrverband und verbrachte so viel Zeit wie möglich in der Feuerwehr. Er wurde als sehr engagiert und passioniert beschrieben. Dies spiegelte sich auch in seiner Art wider, die Menschen vom Feuerwehrdienst zu begeistern.
Deuschle-Labhard trug auch entscheidend dazu bei, dass 1907 ein sehr bedeutendes System in Baden eingeführt wurde – der Pikettdienst. Dieses System veränderte nicht nur die Badener Feuerwehr, sondern die Rettungsorganisationen rund um die Welt. In Baden wurden diese Veränderungen durch ein besonderes Ereignis in Gang gesetzt: der Brand in der Spinnerei Spoerry von 1904. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Bevölkerung mit Kanonenschüssen vom Stadtturm auf einen Brand aufmerksam gemacht. Alle Männer der Stadt waren verpflichtet mit Falteimern die Löscharbeiten zu unterstützen. Beim Spinnereibrand, der von gigantischem Ausmass war, wurde den Bewohnerinnen und Bewohnern klar, dass es eine Veränderung braucht. So wurde der Pikettdienst ins Leben gerufen.
Von der Bürgerwehr zum Pikettdienst, vom Falteimer zum Tanklöschfahrzeug und von der blossen Uniform zum raffinierten Schutzanzug – so könnte man den über Jahre dauernden Fortschritt der Badener Feuerwehr zusammenfassen. Doch der Fortschritt ist auch heute noch ein ständiger Begleiter der Feuerwehr und mit der Fusion der Feuerwehren Baden und Turgi stehen aktuell weitere Veränderungen auch für die Bevölkerung an.
Postkarte des städtischen Krankenhauses (1912)

Unter den vielen Postkarten, die im Historischen Museum Baden aufbewahrt werden, ist auch eine kleine, unscheinbare Postkarte aus dem Jahr 1912, welche das städtische Krankenhaus abbildet. Wir haben diese Postkarte ausgewählt, um die Geschichte des Krankenhauses zu erforschen.
Das Leben hat seinen Beginn gewöhnlicherweise in einem Krankenhaus. Seit Anfang an ist man auf eine Pflegeeinrichtung anegwiesen. Krankenhäuser retten Tausende von Leben, heilen Wunden, Krankheiten und verbessern im Allgemeinem die Lebensqualität und die Lebenserwartung der Bevölkerung. Deswegen spielte das städtische Krankenhaus Baden eine zentrale Rolle für die Gesellschaft in der Region Baden.
Der Ursprung greift tief in die Geschichte zurück. Gegründet wurde das städtische Krankenhaus Baden vor knapp 600 Jahren unter dem Namen Agnesen-Spital von der Königin Agnes von Ungarn. Die Gründung dieses Spitales liegt leider einem traurigen Anlass zugrunde. Die Königin kam auf die Idee, ein Krankenhaus zu errichten, nachdem ihr Vater in Windisch ermordetet wurde, denn hätte es damals schon ein Krankenhaus in der Region Baden gegeben, wäre der Vater vielleicht dem Tod entkommen. Dank grosszügigen Spenden, Stiftungen und Unterstützung der Habsburger konnte sich das Krankenhaus über Jahrhunderte aufrechterhalten. Dies war auch von Nöten, denn damals waren Krankenhäuser leider noch nicht sehr verbreitet und natürlich auch noch nicht überall so fortgeschritten.
Baden war unter anderem wegen den Badener Bäder weit bekannt. Dadurch wurden viele Patienten nach Baden gelockt, wodurch das Spital auch eine Vielzahl nicht ortsbürgerlicher Patienten hatte, welche auch behandelt werden mussten. Deshalb erwartete man auch einen gewissen Standard, denn es gab Leute, welche einen langen Weg auf sich nahmen, um von den Gesundheitseinrichtungen in Baden zu profitieren. Obwohl die Kurorte selbst auch medizinische Versorgung anboten, wurden die schwer verletzten Patienten in den meisten Fällen an das Stadtspital überwiesen.
Nach all diesen Erfolgen des Agnesen Spitals folgte im 19. Jahrhundert eine Krisenzeit. In Baden gab es 1888 für 25 Jahre keine richtige Gesundheitseinrichtung. Während dieser Zeit diente das Kornhaus unten in der Altstadt als Provisorium des Krankenhauses. In diesen Jahren wurde das Stadtspital im ehemaligen Siechenhaus geführt. Die Anzahl an Patienten nahmen von Jahr zu Jahr stark zu und schon bald merkte man, dass ein richtiges Stadtspital für die vielen Patienten nötig sei. Die eigentliche Gründung des städtischen Krankenhauses Baden erfolgte erst im Jahre 1912. Das heisst, ab diesem Zeitpunkt an war das Krankenhaus an dem Standort des heutigen Regionalen Pflegezentrum Baden. Unsere Postkarte wurde 1912 anlässlich der Gründung des Krankenhauses gedruckt. Man war so stolz, so ein Krankenhaus in Baden zu haben, dass man es sogar auf Postkarten abdruckte. Die Patienten benutzten solche Postkarten, um mit Verwandten und Bekannten zu kommunizieren. Unsere Postkarte wurde zum Beispiel einem Mann in Aarau geschickt.
Nach 1912 hatte der Kanton die zentrale Rolle bei der Leitung des städtischen Krankenhauses, wie auch der Finanzierung des Stadtspitals. Im neuen Spital standen 100 Betten zur Verfügung. Endlich hatte Baden wieder ein richtiges und funktionstüchtiges Krankenhaus. Dennoch reichten die Einrichtungen nicht lange, im Jahr 1938 erfolgte dann der Ausbau. Mit den Erweiterungsbauten wurde das Spital etwas entlastet. 1943 kam dann der erste chirurgische Chefarzt und gleichzeitig baute man die Operationssäle aus. Das Krankenhaus wurde laufend modernisiert und war inzwischen nicht mehr nur ein Stadtspital, sondern nahm bereits die Funktion eines Kantonsspitals ein. Dies führte zu einer Überlastung des Personals, und zwar nicht nur bei den Pflegern und Ärzten, sondern auch beim hauseigenen Gärtner. Dieser war nämlich jahrelang gleichzeitig Chauffeur des Krankenwagens.
Wegen der fehlenden Infrastruktur entstand bereits in den 1950er-Jahren der Wunsch, ein Kantonsspital im östlichen Aargau zu errichten. Dies wurde 1978 schliesslich Realität. Mit der Eröffnung des Kantonsspitals Baden ging die Geschichte des städtischen Krankenhaus zu Ende und unsere Postkarte von 1912 verschwand in der Sammlung des Historischen Museums Baden.
Pläne für ein neues Grand Hotel (1915)
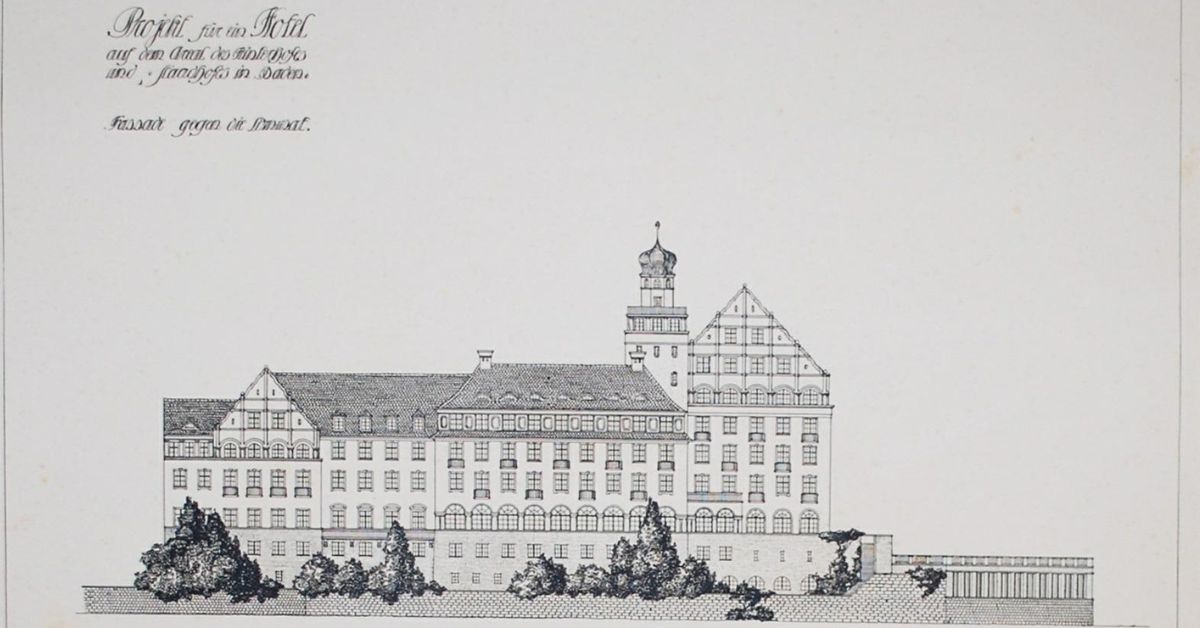
Im Stadtarchiv Baden führt uns ein Entwurf eines Luxushotels aus dem Jahr 1914 zurück in die Geschichte der Bäderstadt Baden im Frühen 20. Jahrhundert:
In den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs erlebte der Tourismus in der Schweiz seine Blütezeit. Diese Ära war geprägt von einer Welle der Innovation und Kreativität, die zu der Entstehung einiges der prächtigsten, beeindruckendsten und luxuriösesten Hotels führte, die die Welt je gesehen hat. In dieser Zeit entstanden die Grund- und Gebäudeaufrisse für ein neues Grandhotel in Baden.
Der Schweizer Architekt Albert Fröhlich sollte die Entwürfe gestalten und das Projekt leiten, welches vom Besitzer des bestehenden Grand Hotels, Herrn Hafen, in Auftrag gegeben wurde. Fröhlich hatte bis dahin hauptsächlich Krematorien gebaut. Weshalb wurde ausgerechnet er zum Leiter eines der grössten Projekte, welche Baden je gesehen hatte, auserkoren? Die Erklärung ist einfach: Albert Fröhlich war sehr vertraut mit Baden, da er dort seine Berufslehre abgeschlossen hatte.
Während der Belle Epoque war der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Baden. So war Baden auch Urlaubsort für einige namenhafte Gäste, wie Marie & Pierre Curie. Gäste aus Frankreich kamen nämlich lieber in die Schweiz als ins Deutsche Kaiserreich, mit dem sich Frankreich ums Elsass stritt. Die Grundstücke an der Limmat waren besonders beliebt und umkämpft, da jder ambitionierte Hotelier in ihren Besitz kommen wollte. Denn von hier aus konnte man in die warmen Thermen steigen und einen Spaziergang über die Lägern unternehmen.
Blicken wir auf das Jahr 1914 zurück: Der Tourismus in Baden boomte und das Bürgertum und der (ausländische) Adel waren bereit, viel Geld auszugeben. Sie hatten den Anspruch, egal zu welchem Preis, das Beste vom Besten zu erhalten. Unterkünfte wie das Hotel Blume, das bereits existierende Grand Hotel und der Limmathof hatten ganzjährig offen und waren immer ausgebucht. Doch die Träume des deutschen Unternehmers Hafen waren riesig. Er wollte neben seinem Verkaufsschlager, dem Grand Hotel, einen neuen Hotelkomplex in Baden errichten. Dieser sollte allerdings nicht mit dem «alten» Grand Hotel verbunden sein, sondern auf eigenen Beinen stehen. Er sollte anstelle des «Staadhofs» errichtet werden.
Auf den Gebäudegrund- und aufrissen des neuen Grand Hotels ist gut zu erkennen, dass das Gebäude vom alten Grand Hotel inspiriert ist. Über sechs Stockwerke und sogar noch einen kleinen Turm mit Platz für Hotelzimmer sollte das neue Grand Hotel verfügen.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs am 28. Juli 1914, ging es mit dem Tourismus in Baden stark bergab. Viele Hotels hatten, wie das Grand Hotel, schon Pläne für Erweiterungen und Expansionen vorgesehen. Doch wegen des Krieges legte Herr Hafen das Projekt auf Eis. Die Hoffnung auf ein profitables Geschäftsjahr liess bis in die Saison von 1917/1918 auf sich warten. In der Zwischenzeit hatte Albert Fröhlich schon neue Aufträge annehmen müssen. Herrn Hafen wurde allmählich bewusst, welche immensen Kosten auf ihn zukommen würden und da sein bestehendes Hotel mittlerweile nicht mehr komplett ausgebucht war, begrub er das Projekt.
Schlussendlich hatte das nie realisierte Projekt für einen neuen Hotelkomplex auch Auswirkungen auf das bestehende Grand Hotel. Dieses konnte sich nämlich wirtschaftlich nicht mehr erholen und wurde schliesslich im Jahr 1944 vom Militär gesprengt. So ging ein Teil der Badener Geschichte und die Geschichte eines nur auf dem Zeichenbrett existierenden Grand Hotels zu Ende.
Handgranate (1915)

Der Erste Weltkrieg veränderte die Welt. Eine dieser Veränderungen war die Handgranate. Die von uns ausgewählte Granate aus dem Historischen Museum Baden ist die Besozzi 1915. Erfunden vom Chemiker Luigi Besozzi und seinem Bruder, dem Ingenieur Celeste Besozzi, wurde sie von 1915-1917 produziert und im Jahre 1918 ausser Dienst gestellt. Sie wurde sowohl von der französischen Armee als auch von der italienischen Armee im Krieg eingesetzt.
Die Brüder Besozzi patentierten das Design im März 1915 und die Firma «Industrie Besozzi» begann mit der Produktion für die französische Armee. Das französische Militär war zu diesem Zeitpunkt auf Waffen anderer Nationen angewiesen, da die eigene Kriegsindustrie überfordert war. Die Besozzi-Granate ermöglichte der französischen Armee hierbei die Versorgung mit modernen Granaten, ohne die französische Kriegsindustrie noch mehr auszulasten.
1915 schloss sich Italien den Alliierten im Ersten Weltkrieg an und ein Teil der Produktion der Besozzi-Granate wurde unter Lizenz an französische Hersteller übertragen, damit die italienischen Hersteller für die eigene Armee herstellen konnte. Speziell bei der Besozzi ist im Vergleich zu Modernen Granaten, dass sie mit einem Docht gezündet wird und nicht mit dem Ziehen eines Ringes. Die grundlegende Konstruktion aus gusseisernen Halbkugeln war bei beiden Versionen gleich, jedoch hatte die damalige französische Version einen seitlichen Auslass für den Docht, während die italienische Version den Docht oben hatte.
Die Granaten wurden in Paraffin getaucht zum Imprägnieren. Das Gesamtgewicht inklusive 60 Gramm Sprengstoff beträgt um die 630 Gramm. Die Form und ihre Fragmentierung ermöglichte es den Soldaten, die Granate viel einfacher zu halten, was wegweisend für die Weiterentwicklung zur modernen Granate war.
Die Besozzi-Granate wirkt auf den ersten Blick ungeeignet als Objekt für eine Arbeit über die Badenfahrt. Als eine extreme Fortentwicklung und ein wichtiger Teil der Geschichte der Kriegsindustrie, sahen wir sie jedoch als Symbol für den Krieg, wie auch Krisen, die wegen des Krieges entstanden sind. Das war Grund weshalb wir uns für die Granate als Objekt für unser Twistory-Projekt entschieden haben.
Die Badenfahrt hat nämlich viel mehr mit Krieg und Krisen zu tun als erwartet. So stand in der Festschrift der ersten Badenfahrt 1923: «Es soll uns alle wieder auf das Gemeinsame hinweisen, indem es mit seinem Leuchten das Verbitternde versengt.[…]». Denn mit Anfang des 20. Jahrhunderts, durchlief die Schweizer Bevölkerung mit dem Landesstreik 1918, der Spanischen Grippe und dem Ersten Weltkrieg eine Zeit, die die Bevölkerung nicht nur psychisch und physisch extrem belastet hatte, sondern auch die Gesellschaft zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft immer mehr spaltete. So auch in Baden, wo ein grosser Teil der Bevölkerung verarmte, die BBC jedoch riesige Gewinne machte, weil die ausländische Konkurrenz wegfiel. Um diesem Zerwürfnis ein Ende zu setzen und durch das Zusammenkommen eine gemeinsame Zukunft zu gestalten, wurde die erste Badenfahrt unter dem Namen des Friedenkongresses «Friede von Baden» ins Leben gerufen.
Der Friede von Baden führte 1714 zum Ende des Spanischen Erbfolgekrieges und war der erste internationale Friedenskongress in der Schweiz. Aus ganz Europa kamen damals Delegationen nach Baden, um den Frieden in Europa zu sichern. Mit diesem Frieden als Motto für die Badenfahrt 1923 konnte nicht nur die Geschichte Badens als Ort des Friedens, sondern auch Frieden an sich nach den vielen Krisen und dem Weltkrieg gefeiert werden. Die Badener Bevölkerung sollte endlicher wieder Hoffnung und Freude haben und die Gemeinschaft gestärkt werden.
Das war aber nicht die einzige Badenfahrt, die durch Krieg und Krise geprägt war: Die Badenfahrt 1947 war die erste Badenfahrt nach dem Zweiten Weltkrieg. Während sechs Jahren hatte die Bevölkerung vergessen, was Spass, Freude und Frieden bedeuteten. Man war erst am Anfang des Wiederaufbaus, sowohl geistig als auch physisch. Es herrschte ein Mangel an Lebensmitteln und Arbeitskräften.
Dennoch beschlossen die Organisatoren, die Badenfahrt wie vorgesehen zu veranstalten. Das Fest sollte ein Zeichen der Hoffnung und des Wiederaufbaus sein. Die Menschen in Baden und der umliegenden Region freuten sich auf das Fest und die Möglichkeit, die Sorgen des Krieges vorübergehend hinter sich zu lassen.
Wie wir sehen, ist die hundert Jahre alte Tradition der Badenfahrt vom Krieg geprägt. Der Erste Weltkrieg, in dem die Granate erfunden wurde, und damaligen Krisen beeinflussten die erste Badenfahrt massgeblich. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Badenfahrt als ein Zeichen der Hoffnung gefeiert und sie trägt bis heute zu einem Gefühl des friedlichen Zusammenkommens in der Region Baden bei.
Rinis, Kristian, Aaron und Adriatik
Bettflasche (1900–1930)

Die Spanische Grippe breitete sich zwischen 1918 und 1920 von der Atlantikküste bis in die Schweiz und dort auch nach Baden aus. Während dieser Schreckenszeit begann ein bestimmtes Objekt eine sehr wichtige Rolle für Betroffene einzunehmen und wurde über Jahre hinweg weiterentwickelt: Die Bettflasche. Sie trug zur Genesung, sowie zum Wohlfühlfaktor der Betroffenen bei. Doch was genau hatte es mit dieser Krankheit und dieser noch sehr einfach gehaltenen Bettflasche auf sich?
Die heftigste Pandemie von allen ist bis heute die Spanische Grippe, auch H1N1 genannt. Sie forderte mehr Todesopfer gefordert als der Erste Weltkrieg. Die meisten Opfer waren zwischen 20 und 40 Jahre alt. Jede dritte Person war infiziert. Zu den Betroffenen gehörten vor allem Soldaten und Kriegsgeschädigte,doch auch wohlgenährte MittelstandsbürgerInnen, wie z.B. Politiker und viele weitere wichtige Personen. Die Spanische Grippe hatte oft normale Symptome einer Grippeerkrankung, also Husten, Fieber und Gliederschmerzen. Diese waren an sich nicht besonders gefährlich, doch die dabei entstandene Lungenentzündung bedeutete für viele den Tod. Erkrankte liefen dunkelblau an aufgrund der Unterversorgung mit Sauerstoff. Oft wurde die Spanische Grippe deshalb für die Pest gehalten.
Bereits im Juni 1918 erreichte der Erreger die Stadt Baden. Betroffene entwickelten zunächst normale Grippesymptome, wie Husten, Fieber und Gliederschmerzen. An und für sich noch nichts Bedrohliches. Doch was viele zu Beginn noch als kratzendes Gefühl im Rachen wahrnahmen, entwickelte sich innert kürzester Zeit zu einer fatalen Lungenentzündung. Diese endete für viele mit dem Tod.
Im zweiten Halbjahr 1918 waren 2600 Personen, also mehr als ein Viertel der Wohnbevölkerung Badens, betroffen. Spitäler und Krankenpersonal waren völlig ausgelastet. Nun gab es spezielle Grippebetten und selbst Schulzimmer wurden als Notspitäler hergerichtet. Neben Gemeindeschwestern und dem Samariterverein wurden zudem Freiwillige für die Pflege angelernt und eingespannt.
Aufgrund der immer weiter steigenden Fallzahlen mussten unzählige Massnahmen ergriffen werden. Um Ansteckungen zu vermeiden, schränkten die Leute ihre sozialen Kontakte ein und verwendeten Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken. Wenn man sich dennoch infizierte, nahm man Medikamente wie Echinacea, das eine beruhigende und kräftigende Wirkung gehabt und den Appetit und die Verdauung angeregt haben soll. Eine andere Methode war, eine Bettflasche zu verwenden, um vor allem den Schüttelfrost zu bekämpfen.
Die aus Zink angefertigte Bettflasche das wichtigste Hilfsmittel, um Schüttelfrost entgegenzuwirken. Trotz der damals noch sehr unkomfortablen «Metallflasche» und der Tatsache, dass die Wärme der Bettflasche keine heilende Wirkung hatte, führte sie zu einem erheblichen Anstieg des Wohlbefindens. Brandverletzungen wurden durch einen selbstgehäkelten Überzug – wie auch bei unserer Bettflasche – vermeiden.
Die erste Idee der Bettflasche liegt schon sehr lange zurück. Unser Museumsobjekt war eines der ersten Modelle einer «richtigen» Bettflasche, die in Baden in den 1920er Jahren zum Gebrauch kamen. Vor vielen Jahren verwendete man bereits erwärmte Ziegelsteine, Steine oder warme Holzbretter, um das Bett vorzuwärmen. Als Bettflasche bezeichnete man diese aber noch nicht. Bei der Herstellung der Hülle unseres Museumsobjekts wurde hauptsächlich mit Metall, Zink, Eisen und Kupfer gearbeitet. Ausserdem gab es auch verschiedene Füllmethoden. Man verwendete nicht nur heisses Wasser, sondern auch heissen Sand.
Seit der Spanischen Grippe hat die Bettflasche eine noch wichtigere Rolle in der Badener Geschichte eingenommen. Man kam nämlich auf die Idee, die damalige Bettflasche zu verbessern und brachte so die Weiterentwicklung bis zum heutigen Modell ins Rollen. Der erste Schritt war, dass die harte Hülle mit etwas Bequemerem ausgetauscht wurde. Dadurch entstanden auffüllbare Stoffsäckchen. Das erste Kirschkernsäckchen kam auf den Markt, gefolgt von der heutigen Bettflasche.
Die 1920er Jahre gingen mit vielen Schreckensmomenten in die Geschichte ein. Unser Museumsobjekt zeigt aber, dass eine Erfindung von damals auch heute noch immer die gleiche Bedeutsamkeit trägt. Die Bettflasche hat im letzten Jahrhundert zahlreichen Bürgern das Wohlbefinden gestärkt und deren Leiden verringert. Heutzutage greift man bei einer Krankheit ebenfalls häufig zur Bettflasche, jedoch hat sich das Modell in Form und Material stark weiterentwickelt. Die Bettflasche ist nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.
Zapfen (1901–1950)

Der Zapfen - ein prägendes Element für die Entwicklung der Badehotels im 20. Jahrhundert?
Die Archäologin Frau Schaer beginnt eine Ausgrabung an den Badener Bädern. Der Beginn der Ausgrabungen ist sehr grob und wird erleichtert durch einen Bagger. Viel Schutt ist im Wege. Nachdem der Schutt abgetragen ist, erkennt sie erste Strukturen und Verfärbungen eines möglichen Fundes. Mit mit Pickel und Schaufel wird weitergegraben, bis ein Objekt zu erkennen ist, welches umgeben ist von Mineralien, Sand und Kalk. Im letzten Schritt wird es zu den Konservatoren weitergeleitet, welche sich das Objekt noch genauer unter die Lupe nehmen. Beim Zersägen stossen sie auf schwer durchtrennbares Holz, bei dem sie sogar die Sägeblätter auswechseln müssen. Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Badezapfen.
Der Badezapfen wurde zwar bereits von den Römern verwendet aber auch noch die grossen Badener Badehotels im 20. Jahrhundert hatten Badezapfen. Badener Hotels waren bei Touristen aus deim In- und Ausland beliebt wegen ihrer Becken mit Thermalwasser. Der Ein- und Auslauf des Thermalwassers in diesen Hotelbecken wurde durch Badezapfen reguliert, welche verhinderten, dass sich der Wasserpegel ohne menschlichen Einfluss veränderte.
Zapfen waren auch wichtig für die Substitution des verschmutzten Wassers und die Temperaturregulierung. Deshalb war auch das Ziehen des Zapfens in den Hotelbecken streng untersagt. Es gab aber dennoch immer wieder Fälle, in denen genau das gemacht wurde. Der Ennetbadener J.L Bucher zog zum Beispiel 1818 einen Badezapfen und wurde deswegen verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, die Regeln zu missachten und den Anstand zu beleidigen, und der Gemeinderat bestrafte ihn mit einer Strafe von 2 Batzen und einer zehnstündigen Verhaftung, da nur der Inhaber des Hotels das Recht hatte, den Zapfen aus den Bädern zu entfernen.
Badezapfen bestanden ursprünglich aus Holz, denn Holz verfügt über viele Vorteile; Verformbarkeit, Hitzeresistenz (bis 40–50 °C), eine einfache Produktion (schnitzen), einen ausreichenden Ressourcenvorrat und zudem ist es ein ökologischer und gesunder Baustoff. Dazu nimmt Holz Wasser aus der Umgebung auf und quillt auf. Metallzapfen, wie sie von den Römern in Frankreich benutzt werden, waren keine gute Option für die Badener Bäder, da diese durch das Quellwasser schnell verkalkt wären. Metallzapfen waren auch schwer herzustellen und sie verformten sich. Holzzapfen hingegen wurden sogar noch bis vor manchen Jahren in Baden zur Verstopfung der Thermalwasserleitungen benutzt. Mit der Zeit wurden Holzzapfen aber immer häufiger durch Gummi ergänzt. Gummi haftete ohne zu kleben, war extrem dehnbar und nahm keine Krankheitskeime auf. Wie auch bei unserem Foto erkennbar, waren Zapfen umhüllt von einem Stoff, welcher die Verdichtung des Auslaufs nochmals unterstützte.
Zapfen gab es in unterschiedlichen Grössen und Formen. Es gabsie in der Form eines Keiles, eines Konuses, oder eines Hundeknochens. Der Zapfen, welchen wir genauer betrachtet haben, ist einer des Hotels Hirschen, welcher im 18. und 19. Jahrhundert für die grossen Becken gebraucht wurde.
Der Zapfen wurde mit einem Holzhammer in den Boden geschlagen, sodass er sich nicht lösen konnte. Unser Zapfen wurde ursprünglich in einem Bassin der Barockzeit, in der man mit der eigenen Familie und engsten Bekannten im Becken war, benutzt. Später wurde er vom Hotel Hirschen übernommen.
Hobbysammler haben auch schon oft Zapfen entdeckt, dürfen sie aber nicht behalten, weil sie als Kulturgüter dem Kanton gehören.
Müller-Bräu-Flasche (1923)

Eine grüne Glasflasche aus dem Jahr 1923 führt uns durch die Geschichte der Müllerbräu.
Im 19. Jahrhundert waren Flaschen schon bekannt, allerdings noch nicht verbreitet. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts dienten Krüge und Behälter aus Holz, Ton, Steingut oder Glas als Bierbehälter. Mit der Erfindung des Bügelverschlusses um 1890 wurde die Bierflasche alltagstauglich.
Auch die im Jahr 1897 als Familienunternehmen gegründete Müllerbräu füllte ihr Bier in Glasflaschen ab. Neben der Einführung der Glasflasche war die Linde-Eismaschine eine wichtige Innovation, welche der Müllerbräu zu ihrem Erfolg verhalf. Durch die Erfindung der Eismaschine wurde der Arbeitsvorgang verbessert, aber auch teurer gemacht.
Die Anschaffung von Bierflaschen stellte eine weitere finanzielle Belastung für die Brauereien dar, obwohl die Flaschen durch Produktionsfortschritte billiger geworden waren. Dies führte dazu, dass sich nur zwei der damals etwa dutzend Brauereien in Baden durchsetzen konnten. Somit gab es im ganzen Kanton Aargau nur noch fünf Brauereien.
Unsere Flasche wurde im Jahr 1923 abgefüllt, möglicherweise für die erste Badenfahrt der Geschichte, denn 1923 war das Geburtsjahr der Badenfahrt. Seither entwickelte sich die Badenfahrt zum grössten städtischen Volksfest der Schweiz. 2017 wurden 1.2 Millionen Besucher mit 150’000 Liter Bier versorgt.
Hopfen bekommt durch Lichteinwirkung einen schlechteren Geschmack und produziert gesundheitsschädliche Substanzen. Deshalb verloren Glasflaschen an Popularität. Im Vergleich zu Flaschen sind Dosen lichtundurchlässig. Somit ist Dosenbier länger haltbar.
Unsere Bierflasche aus dem Archiv des Historischen Museums Baden, wurde am selben Standort abgefüllt, wie es die Müllerbräu noch heute tut. Dies wird sich 2023 mit der Umstrukturierung der Müllerbräu ändern. Neu wird ein Grossteil des Biers von der Schaffhauser Brauerei Falken produziert, denn die Brauerei verlegt die Produktion für Detailhandel und Gastronomie nach Schaffhausen. Künftig werden nur noch Spezialitäten in der Gasthofbrauerei in Baden produziert.
Einer der Hauptgründe für die Umstrukturierung ist die Lage der Brauerei. Sie steht mitten in Baden, direkt neben dem Bahnhof und umgeben von Wohnungen. Dort stösst man immer mehr auf logistische Schwierigkeiten, welche die Brauerei an ihre Grenzen bringt.
Der Umstrukturierungsplan umfasst zusätzlich den Bau von neuen Wohnungen. Der in Baden berühmte Biergarten ist ebenfalls von der Umstrukturierung betroffen. Trotzdem wird der Charme und die Grundphilosophie der Brauerei nicht darunter leiden.
Stubenwagen (1920-1930)

Der Stubenwagen ist ein auf Räder stehendes Babybett, welches man leicht transportieren kann. Er gehörte früher zu einem wichtigen Bestandteil der Babyausstattung. Auch wurde er oft als Erbstück weitergegeben.
Im Lager des Historischen Museum Badens befindet sich ein solcher Stubenwagen. Schon lange verweilt dieser im Museum und hat auch schon einige Holzwurmlöcher. Davon inspiriert, haben wir uns intensiv mit dem Thema Familienleben in Baden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Besonders haben wir uns das Leben von Arbeiterfamilien angeschaut, denn von ihnen gab es zu dieser Zeit viele.
Mit Baden als wichtiges Zentrum der Industrialisierung, aufgrund von Firmen wie BBC, heute bekannt als ABB, wurden viele Arbeiterfamilien in die Region gezogen. Das Arbeiten in Fabriken veranlasste Arbeiterfamilien oft dazu, in die Stadt zu ziehen. Dort gab es allerdings weniger Platz als auf dem Land, weshalb Familien häufig auf engstem Raum zusammenleben mussten. Nicht selten wohnten mehrere Familien zusammen in einer Wohnung oder hatten Untermieter.
Während es in den Städten für Arbeiterfamilien oft eng wurde, wurde dieses Platzproblem für Familien der Mittelschicht eher weniger zum Verhängnis, da sie anders oft in eher ländlicheren Regionen lebten, wo es weniger eng war. Zu den gewöhnlichen Berufen der Mittelschicht gehörten bspw. Beamte, Lehrer oder Bauern.
Durch die Fortschritte, die auch die Medizin machte, und die generell besseren Lebensbedingungen, wurde auch die Kindersterblichkeit weniger. Folglich bekamen die Frauen von da an tendenziell eher weniger Kinder. Bei der wachsenden Mittelschicht wurde deshalb das „bürgerliche Familienideal“ besonders wichtig. Hauptsächlich verschärfte dieses Ideal die klare Aufteilung der Arbeiten im Haushalt und den Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Frauen blieben zuhause und kümmerten sich um den Haushalt und die Kinder. Hierbei war der Stubenwagen praktisch, da die Mutter das Kind überall in der Wohnung mitnehmen konnte. Während die Mutter dann sich um die Hausarbeiten kümmerte, konnte das Kind im Stubenwagen daneben schlummern.
In der Erziehung wurde besonders grossen Wert auf Disziplin gesetzt. Daraus schlussfolgernd wurden Mädchen und Jungen unterschiedlich erzogen. Ein Junge sollte unabhängig und stark sein, wobei ein Mädchen sich auf das Eheleben und das Muttersein vorbereiteten musste.
Zuvor wurden Kinder oft als zusätzliche Arbeitskraft genutzt, aber zu dieser Zeit wurde jedoch die Bildung der Kinder immer wichtiger. In der Schule spielte Leistung, Gehorsamkeit und Disziplin der Kinder eine grosse und wichtige Rolle. Gleichzeitig begann man aber auch die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Mit der Zeit wurden somit auch die «Disziplinierenden Massnahmen» weniger.
Obwohl man oft meint, dass Kinderarbeit im 20. Jahrhundert in der Schweiz keine Rolle mehr spielte, war sie vor noch gar nicht allzu langer Zeit die Realität von vielen Schweizer Kindern. Wenn es Schweizer Familien an Geld mangelte, wurden Kinder teils noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts verdingt. Schätzungsweise hunderttausende von Kindern aus ärmsten Verhältnissen wurden in die Landwirtschaft vermittelt und dort als günstige Arbeitskraft ausgenutzt. Meist lebten diese Kinder dann unter abscheulichen Umständen, in denen sie physisch und psychisch misshandelt wurden, wobei es teils auch zu sexuellen Übergriffen kam.
Nach dem Überwinden dieses dunkeln Kapitels der Schweizer Geschichte wurde dieses Thema nur selten aufgegriffen. Letztendlich haben einige der ehemaligen Verdingkinder haben nun doch ihre Stimme erhalten und versuchen das Thema in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu drücken. Trotz der Unterschiede von Familie zu Familie können wir nun also schliessen, dass die Erziehung von damals tendenziell strenger war, die Familien grösser waren und je nach dem der Wohnraum oft knapper war. Ob man sich nun einen solchen Stubenwagen leisten konnte oder nicht, kam auf das jeweilige Vermögen der Familie an.
Schreibmaschine (1920-1930)
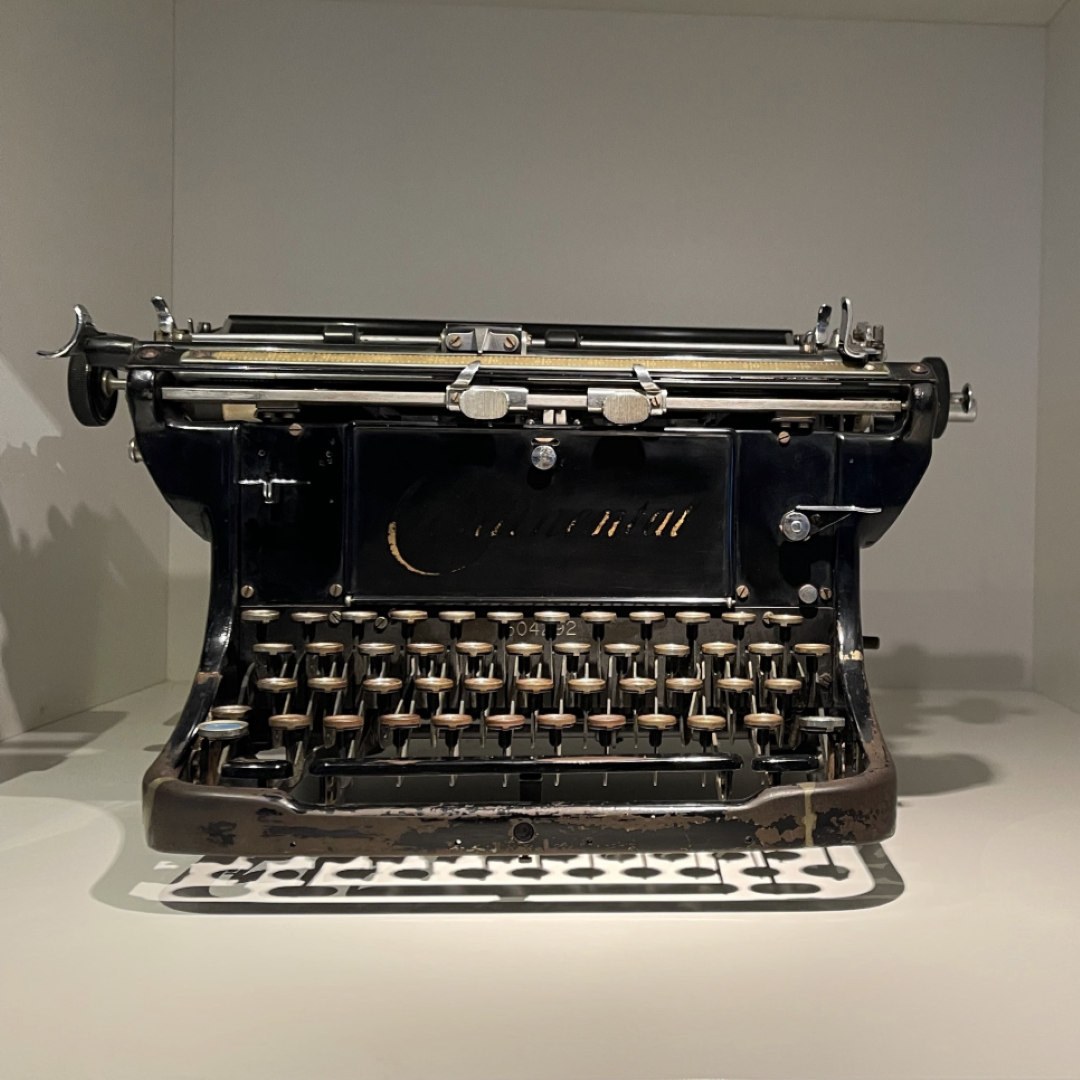
Die Schreibmaschine erleichterte der Menschheit gegen Ende des 19. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert viele Arbeiten. Wir wollten genaueres über die revolutionäre Maschine erfahren und haben die Continental Schreibmaschine ausgewählt, die 1920 bis etwa 1930 in einem Schreibbüro eingesetzt wurde.
1714 wurde die erste Schreibmaschine von dem Mathematiker Henry Mill erfunden. Sie wurde jedoch nie umgesetzt. Als ,,richtiger’’ Erfinder wird Pellegrino Turri angesehen. Seine Version stammt aus dem Jahr 1808 und ist der Vorfahre der Schreibmaschine. 20 Jahre später kam der erste, eher erfolgslose Typographer auf den Markt. Einige Jahre später brachte Christopher Latham Sholes seine in Umlauf. Sie war vergleichsweise modern und praktisch und verhalf der Schreibmaschine zu einem industriellen Erfolg.
Die Continental Schreibmaschinen wurden von George C. Blickensderfer erfunden. Nachdem er einen grossen Erfolg mit Schreibmaschinen hatte, gründete er die Continental Schreibmaschinen AG in Zürich mit einem Schweizer Geschäftsmann namens Eugen Lutz. Es wurde zu einer der grössten Schreibmaschinenhersteller der Schweiz. Neben Schreibmaschinen wurden noch andere Büroartikel verkauft. Die Continental Schreibmaschinen wurden von den Wanderer-Werken produziert. Ursprünglich verkaufte die Firma Fahrräder. Aber schon bald begann sie die Produktion von Schreibmaschinen. Ihre ersten Modelle waren die Typenhebelmaschinen, welche ihnen grossen Erfolg brachten.
Auch unsere ausgewählte Maschine ist eine Typenhebelmaschine. Um einen Buchstaben oder eine Zahl auf das Papier zu bekommen, muss eine Taste gedrückt werden. Diese Taste löst einen Hebelmechanismus aus und so wird der Buchstabe, die Zahl oder das Symbol auf das Farbband gedrückt. Durch das Farbband wird es dann auf das Papier gedrückt. Bei der ausgewählten Schreibmaschine ist die Tastatur nach dem QWERTZ System angeordnet. Es wird wegen den ersten sechs Buchstaben, die man von oben links sieht, so genannt.
Die Schreibmaschine aus dem Historischen Museum hat keinen engen Bezug zu Baden. Sie stand nämlich in einem Zürcher Schreibbüro und wurde eingesetzt, um Gerichtsverfahren abzutippen. Sie steht jetzt jedoch in Baden, da der Besitzer sie dem Historischen Museum geliehen hat.
Was kann uns eine Schreibmaschine über Baden verraten? Als die Schreibmaschine an Popularität gewann, gab es viele Leute, die fürchteten, dass sie die menschlichen Arbeitskräfte ersetzen würden. Da die Schreibmaschinen aber von Menschen bedient werden müssen, waren die Bedenken grundlos. So führten die Schreibmaschinen nämlich eher zu mehr Arbeitsplätzen. Sie wurden in sehr vielen Bereichen eingesetzt. Zum Beispiel im Journalismus, in Schulen und Universitäten, oder in diversen Büros. In Baden gab es anfangs des 20. Jahrhunderts viele Unternehmen mit Büros. Es liegt auf der Hand, dass dort auch Schreibmaschinen eingesetzt wurden. Auch für Schriftsteller stellte die Schreibmaschine ein sehr grosser Fortschritt dar.
Die Schreibmaschine wurde hauptsächlich von Frauen gebraucht. Daher kommt der Name das “Schreibmaschinenfräulein”. Sie konnte sowohl zu Hause als auch im Büro arbeiten, was für die Frauen für die damalige Zeit ein grosser Vorteil war. Das war auch in Baden der Fall. Unternehmen wie die BBC hatten viele Sekretärinnen, deren Job hauptsächlich darin bestand, Telefone zu beantworten und Briefe, Berichte und sonstige Dokumente zu tippen. Wer weiss, vielleicht hatten sie auch Continental Maschinen.
Die Schreibmaschine wurde zwar gegen Ende des 20. Jahrhunders durch Computer ersetzt, jedoch war sie trotzdem ein grosser Schritt für die wirtschaftliche Effizienzsteigerung. Sie war das erste technische Kommunikationsmittel und früher kaum wegzudenken, ähnlich wie wir uns heute ein Leben ohne Computer nicht mehr vorstellen können.
Lee-Roy, Nicole, Rachel, Roberto
Quarzlampe (1925-1935)

Wer mag es denn nicht, sich einfach mal in die Sonne zu legen? Die warme Sonne küsst die Haut und eine leichte Brise fährt einem über den Körper, man sehnt sich nach einer leichten Bräunung der Haut.
Vor gerade mal 130 Jahren war dem nicht so. Europa war mitten in der Zeit der Industrialisierung. Die Städte waren voller Industrien und Fabriken. Menschen haben von morgens bis abends gearbeitet, und von Ferien wurde schon gar nicht mehr gesprochen. Der Himmel voller Russ und die Umwelt grau und traurig. Wer möchte sich denn hier noch in die Sonne legen?
Die Menschen hatten einen Sonnenmangel, doch wie wir alle wissen, ist die Sonne sehr wichtig. Sie fördert die Vitamin D-Bildung. Somit verstärkt sie auch unser Immunsystem und kann zugleich als vorbeugende Behandlung gegen schwerwiegende Krankheiten helfen. Es brauchte also möglichst dringend einen Sonnenersatz.
1890 entstanden deshalb die ersten Bestrahlungsapparate, bis man 1920 dann das erste Mal von der Höhensonne sprach. Eine solche Höhensonne, welche im Grunde genommen eine Quarzlampe ohne Schutzglas ist, durften wir im Badener Stadtarchiv betrachten.
Bei der künstlichen Höhensonne handelt es sich um eine Lampe, die Ultraviolett-Strahlung in einem ganz bestimmten Spektralabschnitt von sich gibt. Diese wurde einerseits für die Behandlung von Tuberkulose verwendet. Andererseits wurde sie auch als Vorbeugung gegen verschiedene Krankheiten genutzt. Vor allem für die Arbeiter diente sie zur Leistungssteigerung: Dies war äussert wichtig, da es starke und eifrige Arbeiter für die Industrien brauchte. Von Familien wurde die Höhensonne meist als Ferien- resp. Sonnenersatz genutzt.
Zu dieser Zeit gingen die Menschen entweder zu speziellen Kurorten, wie beispielsweise der Kurort Baden, oder sie besassen selbst eine solche Heimsonne. Die Heimsonne kostete zwischen 400 und 600 CHF. Eine Strahlungstherapie in einem Solarium mit der einfach zu betätigenden Höhensonne und der daraus resultierenden Bräunung der Haut nannte man Lichtdusche. Dieser Begriff kommt aus den antiken Sonnenkulten, eine überwiegend von Nudisten geprägte Kultur, bei der die Sonne ein wichtiger Bestandteil war. Beim sogenannten Lichtduschen stellte oder legte man sich ca. drei Minuten unter eine ganz hell brennende Höhensonne. Da die Augen für ultraviolette Strahlen empfindlich sind, muss man während der Bestrahlung eine Schutzbrille aufsetzen oder aber die Augen geschlossen halten. Nach einigen Stunden sollte sich ein Resultat auf der Haut blicken lassen. Dieser Vorgang wiederholte man alle zwei Tage, mit einer etwas verlängerten Bestrahlungszeit.
Auch im Ersten Weltkrieg wurde die Höhensonne genutzt. Die antibakterielle Wirkung der Lampe kam den verwundeten Soldaten zu Gute und verkürzte den Heilungsprozess.
Die Hanauer Höhensonne, wie sie im Museum in Baden zu finden ist, war vermutlich eine häufig eingesetzte Bestrahlungslampe im dazumal grössten Kurort der Schweiz. Menschen aus aller Welt waren bereit, Baden zu besuchen, und reisten mit der Spanisch-Brötli-Bahn in die Kurstadt. Dort genossen sie etliche Therapien und Kuren, wie unsere Bestrahlungstherapie mit der Höhensonne im Grand Hotel Baden mit mehreren hundert Zimmern und Einzelbädern.
Obwohl man schon zu Beginn des 20. Jahrhundert wusste, welche schädlichen Auswirkungen Ultraviolettstrahlung haben können, wurden die Höhensonnen, welche genau auf solchen Strahlungen basieren, weiter genutzt und entwickelt. Erst 1975 wurde die Verwendung der Hanauer Höhensonne dann schliesslich aufgegeben.
Aber auch heute noch werden Lichttherapien durchgeführt. Meistens gegen Depressionssymptome oder Hautkrebs. Die Lampen sind jedoch viel komplexer aufgebaut und erforscht. Um eine schöne Bräunung erhalten, besucht man heutzutage das Solarium oder legt sich wieder unter die Sonne, dabei sollte, nach unserem heutigen Wissensstand, aber nicht die Sonnencreme vergessen gehen.
Marlon, Valerio, Anja, Robin
Badenfahrt-Poster (1937)
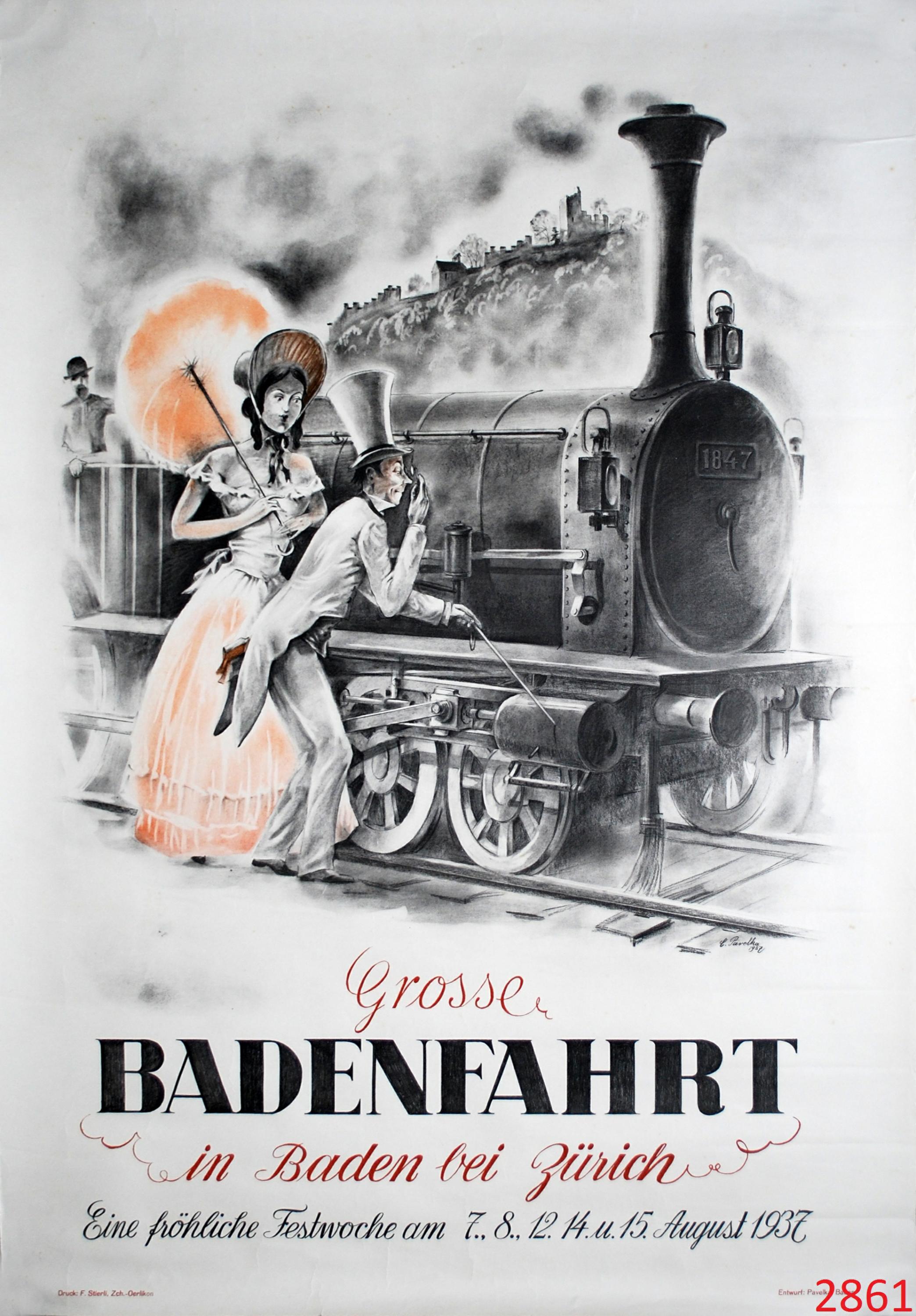
Die Badenfahrt ist aus der Badener Kultur nicht mehr wegzudenken. Ganz Baden und dessen Umgebung kennt dieses riesige Volksfest, welches in der Regel alle 10 Jahre im Sommer stattfindet. Doch eine Badenfahrt war vor mehr als hundert Jahren noch etwas ganz anderes. Früher war Baden ein bekannter Kurort, der schon von den Römern genutzt wurde. Durch den Bau der Spanischbrötlibahn im Jahr 1847 erhoffte man sich mehr Badegäste aus Zürich anlocken zu können.
Auch wenn die Eröffnung gross gefeiert wurde, bezeichnete man diese noch nicht als Badenfahrt im Sinne eines Festes. Eine Badenfahrt zu dieser Zeit hiess, dass man mit der Spanischbrötlibahn nach Baden in die Bäder fuhr und es sich gut gehen liess. Erst im Jahr 1923 kam es dann zur ersten Badenfahrt, welche ein riesiger Erfolg war. Die Stadt Baden war geschmückt mit verschiedenen Attraktionen. Nach dem Umzug traf man sich mit seinen Freunden in den umliegenden Bars und feierte. Insgesamt 20’000 Franken Gewinn spülte die Badenfahrt in die Kassen der Theaterstiftung. Die Bevölkerung im Raum Baden wurde jetzt regelrecht von einem «Badenfahrt-Fieber» gepackt, daher beschloss man 1937 die nächste Badenfahrt stattfinden zu lassen. Mit Werbeplakaten wollte man das Fest noch erfolgreicher werden lassen.
Unser Objekt war ein Werbeplakat für die Badenfahrt 1937. Die Werbeaktion hat sich gelohnt, denn die Badenfahrt 1937 brachte 10’000 Franken an Gewinn. Mit dem Motto «In Baden bei Zürich» konnte Baden noch mehr Besucher anlocken als in der letzten Badenfahrt. Jede Badenfahrt hatte ihr eigenes Motto. 1947 war es «Tragen, Schleppen, Fahren». Die Badenfahrt 1957 fiel aufgrund von Umbauarbeiten, dafür war die Vorfreude auf die Badenfahrt 1967 riesig. Diese fand dann unter dem Motto «Räder machen Leute» statt. Es gab viele grosse Umzüge, welche die Hauptattraktion der Badenfahrt darstellten. Da die Badenfahrt in den Bädern ihren Ursprung hat, bekam die Badenfahrt 1977 das Motto «Im Wasser sind zwöi Liebi». Schon 5 Jahre später wurde dann die sogenannte «kleine Badenfahrt» unter dem Motto «Illusion» gefeiert.
Während all dieser langen Zeit, hat sich die Badenfahrt natürlich auch weiterentwickelt. Früher standen eher die Auftritte mit Sängern, Umzügen und Vorführungen der Turner im Mittelpunkt. In den jüngeren Badenfahrten stand eher die Festwirtschaft im Vordergrund. Der Umzug, welcher in den Anfängen so eine wichtige Rolle gespielt hat, ist in dem Laufe der Zeit nur noch eine nebensächliche Attraktion geworden. An sich hat sich die Badenfahrt aber nicht gross verändert. Historisch gesehen kann man sich die Badenfahrt in Baden nicht mehr wegdenken. Die Badenfahrt wurde zu so einem grossen Volksfest, auf das sich viele Leute riesig freuen. Die Badenfahrt bringt Baden und die umliegenden Regionen alle 10 Jahre wieder zusammen. So auch vor 5 Jahren, als die bisher grösste Badenfahrt 2017 stattfand, mit einer unglaublichen Besucherzahl von ca. 1.2 Millionen. Nächstes Jahr findet das hundertjährige Jubiläum statt, unter dem Motto «Neo», es ist damit zu rechnen, dass sie die Badenfahrt von 2017 bei weitem übertreffen wird. Dabei wird auf die vergangenen Badenfahrten zurückgeschaut und es wird versucht das neue mit dem alten zu verknüpfen.
Militärski (1930-1942)

Die Recherche hat uns dorthin geführt, wo wir es nicht erwartet hätten, und das wird alle erstaunen. Im Depot des Historischen Museums Baden entdeckten wir Holzski. Wir haben anfangs vermutet, dass diese Ski für einfache Freizeitaktivitäten von der Badener Bevölkerung genutzt worden sind. Jedoch war es eine faszinierende Überraschung als wir erfahren haben, dass sie vom Militär genutzt worden sind!
Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Zwar wurde die Schweiz nicht angegriffen, doch auch hier begann die Mobilmachung, um die Schweiz im Kriegsfall verteidigen zu können. Das Alter und weitere Kriterien wurden weggelassen, um die Anzahl möglicher Rekruten zu erhöhen. Das war in jenem Moment wichtig, denn es herrschte eine Notlage. Die Strategie der Schweiz war damals, dass sich die Soldaten im Fall eines Angriffes ins Réduit zurückzogen. Das Réduit bezeichnete eine Reihe von Verteidigungsanlagen im Gebirge.
Es wurden zwar nur wenige Männer aus der Region Baden in das Gotthardgebirge geschickt, doch einer davon war Herr Mollet, der ehemaligen Besitzer der Militärski aus der Sammlung des Historischen Museums Baden. In einer Zeit, in der es noch nicht unsere heutigen Kommunikationsmittel gab, führten ihn die Ski schnell auf weiten Strecken, auch über Gletscher.
Die Schweiz war aufgrund ihrer rohstoffarmen Lage auf Importe aus Nazi Deutschland und dem faschistischen Italien angewiesen, doch der Krieg erschwerte den Handel mit Kriegsgütern und Lebensmitteln. Die Gotthardbahnroute, die für den Transport von Rohstoffen von Deutschland nach Italien von entscheidender Bedeutung war, musste von der Armee bewacht werden.
Die Verwendung von Ski im Militär der Schweiz begann durch einen Zufall. Bei einem Rennen im Jahr 1904, zu dem der Ski-Club Bern vom deutschen Ski-Club Schwarzwald eingeladen wurde, erhielt Hans König Einblick in die Verwendung von Ski durch die deutsche Armee. Die deutsche Armee hatte verschiedene Patrouillen losgeschickt, um taktische Aufgaben zu lösen, und die Ski-Patrouille war dabei die erfolgreichste. Nachdem König einen Artikel darüber veröffentlicht hatte, wurde das Militär der Schweiz auf das Potenzial des Militärskifahrens aufmerksam. Nach weiteren Diskussionen und Beratungen bot das Militärdepartement ab 1905 freiwillige Militärskikurse an.
Das Militärskifahren etablierte sich in der Schweiz, da der Nutzen dieser Fähigkeiten erkannt wurde. Die Hauptaufgaben der militärischen Skifahrer waren Sicherungsaufgaben und Meldedienste. Sie konnten sich lautlos durch verschneite Waldwege bewegen, um Informationen über den möglichen Feind zu sammeln. Besonders wichtig war die Fähigkeit, Meldungen schnell und effizient zu übermitteln. Als ein Rekrut der Gebirgstruppe wurde Herr Mollet die Aufgabe zugeteilt, Nachrichten zu überbringen. Dabei haben er und seine Ski viel erlebt, vielleicht hat er sie deswegen lange Zeit wie einen Schatz gehütet. Jedes Mal, wenn Herr Mollet umzog, kamen nämlich auch die Hölzer mit. So überlebten die Ski die Jahrzehnte, aber lange, ohne beachtet zu werden.
Das mag zwar so klingen, als hätten sie keine signifikante Bedeutung für Baden, jedoch sagen sie mehr als tausend Worte. Dieses Fortbewegungsmittel erzählt eine Geschichte, die eindrückliche und bewegende Geschichte der Schweizer Bevölkerung in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wie etwa derjenigen von Herrn Mollet, der einst in der Region Baden lebte. Heute ruhen die Ski in der Sammlung des Historischen Museums Baden und warten darauf in Erinnerung gerufen zu werden.
Kardelen, Latifa, Shukrona
Erkennungsmarke (1937)
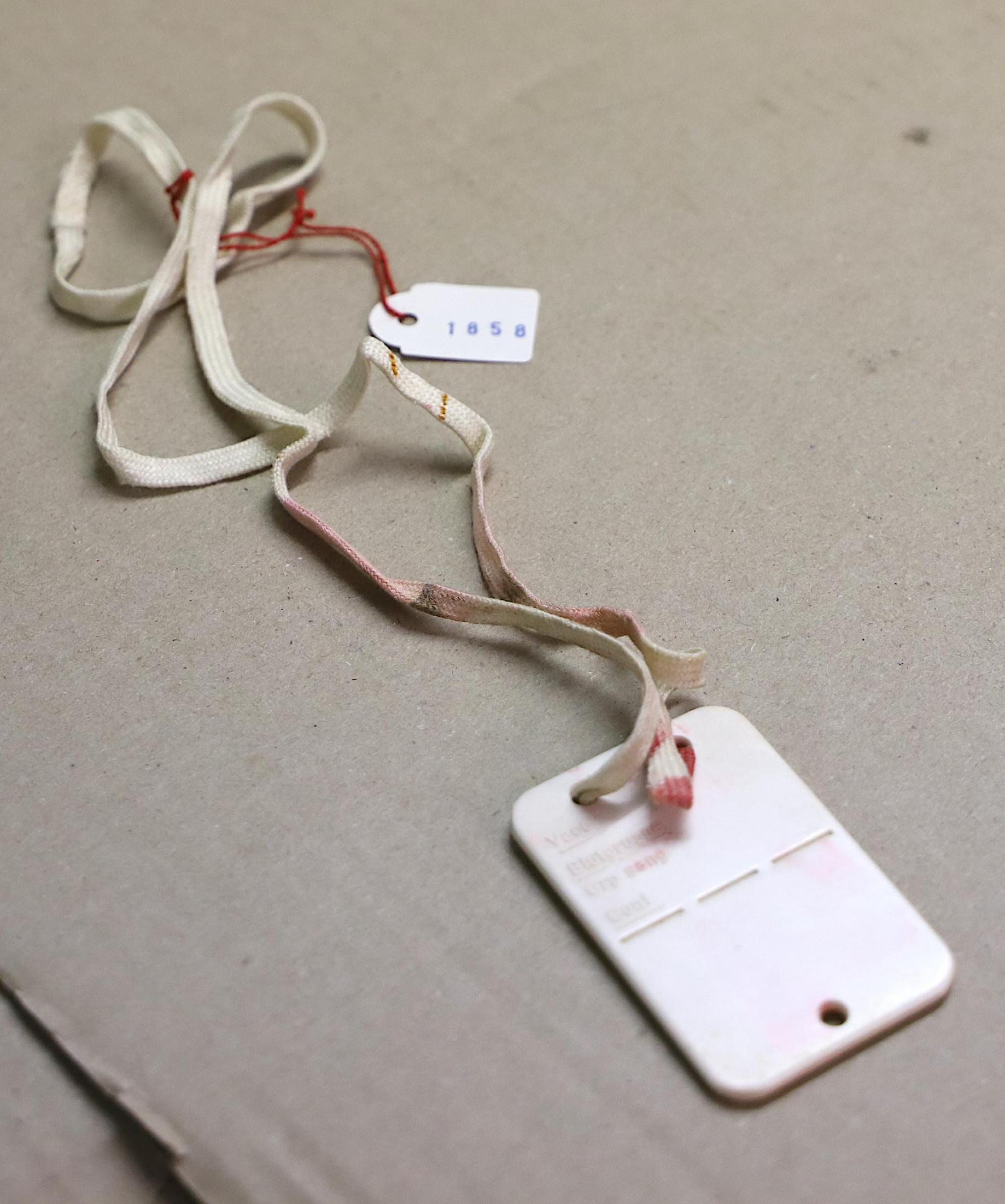
Die Erkennungsmarke – ein Kriegsrelikt, das uns in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eintauchen lässt. Sie prägte von das Schicksal von Millionen von Menschen und war ein grosser Schritt in der Identifikationstechnologie. Die Anzahl der unidentifizierten Todesopfer konnte durch sie deutlich reduziert werden. Was erzählt uns das kleine Metallplättchen über das Kriegsgeschehen in der Schweiz? Und welche Auswirkungen hatte die Einführung der Erkennungsmarke?
Die Erkennungsmarke, die zur obligatorischen Ausrüstung der Soldaten gehörte, tauchte im Jahr 1907 das erste Mal auf – zuvor wurde die Identifizierung mit einer Kapsel geregelt, was den ganzen Prozess kompliziert und umständlich machte. Die Erkennungsmarken waren und sind auch heute noch von grosser Bedeutung: Wurde ein gefallener Soldat gefunden, konnte man diesen schneller identifizieren. Der untere Teil der Marke wurde abgebrochen und an Angehörige versendet – der obere verweilte am Todesopfer. Die zwei Teile, in welche die Marke unterteilt war, waren identisch. Grösstenteils waren diese mit persönlichen Angaben versehen. Dazu gehörten Daten zur Persönlichkeit, Blutgruppe, Konfession, Matrikelnummer, Geburtsdatum und Bürgerort.
Die Bedeutung der Erkennungsmarken in der Schweiz war trotz neutraler politischer Stellung gross: Obwohl kein Krieg auf Schweizer Boden geführt wurde, und das Land auch nie von einer Invasion betroffen war, kam es vereinzelt zu Bombenangriffen, wodurch es einige Todesopfer gab. Um dann auf die schnellstmögliche Identifikationstechnik zurückzugreifen, waren die Erkennungsmarken essenziell.
Die Bestimmungen der Erkennungsmarken galten nicht nur für die Region Baden, sondern waren landesweit in Kraft. Die gesamte Schweizer Armee war im Besitz einer solchen Marke. Die Abgabeorte waren jeweils für mehrere Gemeinden dieselben – in unserem Fall in Dättwil. Von diesem Standpunkt aus wurden verschiedene Evakuationspapiere verteilt sowie Erkennungsmarken und Lebensmittelkarten abgegeben. Unsere Erkennungsmarke war von 1937-1940 in Gebrauch.
Auch unsere heutigen Identitätskarten hatten ihren Ursprung im Zweiten Weltkrieg. Sie stehen im Zusammenhang mit der archivierten Erkennungsmarke. Die Angaben auf den beiden Dokumenten sind beinahe identisch. Betrachten wir die heutigen Funktionen, so fällt auf: Die Identitätskarten dienen aktuell noch immer zur Identifizierung und sind offizielle Dokumente. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Vorfahren aus den Kriegszeiten mit der Erkennungsmarke die Entwicklung eines der aktuell wichtigsten Dokumente mitgeprägt haben.
Neben der Erkennungsmarke diente auch die Lebensmittelkarte zum Bevölkerungs- und Landesschutz. Während des Kriegs war die Ernährung stark von der Rationierung geprägt. Die Verfügbarkeit von Lebensmitteln wurde knapper, der Import von Waren aus dem Ausland gestaltete sich schwieriger. Aufgrund von Handelsblockaden war der freie Güteraustausch zwischen der Schweiz und ihren Nachbarsländern nur noch eingeschränkt möglich. Im Zweiten Weltkrieg wurde in der Schweiz und somit auch hier in Baden viel Wert auf die gleichmässige Verteilung von Lebensmitteln gelegt. Eine gleichmässige Rationierung war enorm wichtig, um die Gleichheit in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Durch die Lebensmittelkarten, die in Form von Bezugsscheinen verwendet wurden, stellte man sicher, dass alle BürgerInnen Zugriff auf die Güter hatten und diese nicht nur dorthin flossen, wo Geld vorhanden war. Wenn man nicht selbst einen Agrarbetrieb führte, waren diese Bezugsscheine die einzige Möglichkeit, an Lebensmittel zu gelangen. Allerdings dienten sie nur zur Berechtigung zum Kauf. Wer die Lebensmittelkarten einlösen wollte, musste also über die nötigen Geldmittel verfügen. Die ursprünglichen A-Karten gestatteten den Bürgern mehrheitlich den Kauf von dazumal sehr teuren Waren, wie Fisch oder Fleisch. Viele Einwohner konnten aufgrund der Überteuerung ihre Coupons nicht einlösen und mussten hungern. Um dieses Problem zu lösen, wurden die B-Karten eingeführt, deren Kosten um ca. ein Drittel niedriger waren als die der A-Karte. Indem man sich auf den Kauf der verfügbaren Lebensmittel wie z.B. Brot, Milch und Eier der B-Karte beschränkte, konnte man für weniger Geld mehr Nahrungsmittel kaufen, und somit die erforderliche Menge an Kalorien zu sich nehmen. Dank der Massnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft gegen die Einschränkung der Lebensmittelversorgung konnten viele weitere Probleme bewältigt werden, die mit der Rationierung einhergingen.
Alle dieser Marken und Karten waren prägend. Ihr Einfluss auf die Entwicklung und den Verlauf bis in die heutige Zeit ist enorm.
Anna Mia, Giannina, Loa, Patricia
Rationierungskarten für Lebensmittel (1939-1941)
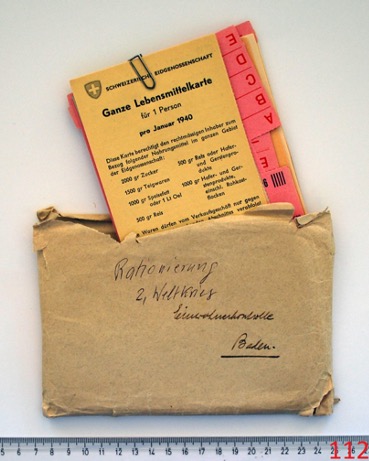
Wir haben deshalb für unser Twistory-Projekt die Rationierungskarte vom Historischen Museum in Baden ausgewählt. Diese Rationierungskarte stammt aus Baden und wurde im Januar 1940 entworfen.
Die Ernährung im Zweiten Weltkrieg war von entscheidender Bedeutung, denn die Verfügbarkeit von gewissen Lebensmitteln hatte einen direkten Einfluss auf das Kriegsgeschehen und auf die Kraft einer Armee. Viele Nahrungsmittel waren knapp oder zum Teil gar nicht verfügbar, weshalb es viele Hungersnöte gab und in verschiedenen Ländern die Bevölkerung an einer Unterernährung litt. Die Regierungen musste eine Lösung finden, um die Folgen der Nahrungsmittelknappheit zu verringern.
Rationierung bedeutet die gerechte Verteilung von knappen Gütern und Dienstleistungen. Mit Rationierungskarten konnten Regierungen im Zweiten Weltkrieg eine gerechte Verteilung der Lebensmittel und anderer lebenswichtiger Güter an die Menschen sicherstellen. Obwohl die Schweiz im Zweiten Weltkrieg neutral war und nicht kämpfte, wurden ab 1938 auch Rationierungskarten eingesetzt. Das Volk wurde zwar von der Regierung dazu aufgefordert, mit der sogenannten Anbauschlacht die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, und ab 1941 wurde das Volk angehalten, zwei Tage in der Woche kein Fleisch zu essen. Auch Preise wurden überwacht. Doch trotzdem wurden Lebensmittel knapp.
Im Oktober 1939 wurden Zucker, Fette (inkl. Öle) sowie Getreideprodukte und Hülsenfrüchte rationiert. Eier wurden im Dezember 1941 rationiert, Fleisch im März 1942, Brot im Oktober und Milch im November.
Rationierungskarten wurden bis 1948 verwendet, um die Bevölkerung auch noch nach dem Krieg mit ausreichend Nahrung zu versorgen. Durch die Rationierungskarten konnte jede Person gleich viele Nahrungsmittel kaufen, so dass alle genügend Essen bekamen, um nicht hungern zu müssen.
Rationierungskarten enthielten verschiedene Coupons, welche es dem Besitzer ermöglichten, bestimmte Lebensmittel zu kaufen. Man musste die Coupons in ein Zahlungsmittel einlösen, um die Rationierung beanspruchen zu können. Um Betrug und Fälschungen vorzubeugen, wurden die Rationierungskarten auf einem speziellem Papier gedruckt, das schwer zu kopieren oder zu manipulieren war.
Die Menge, die eine Person an Nahrung bekam, bestimmte die Regierung. Die Entscheide basierten auf der verfügbaren Nahrungsmenge und den individuellen Bedürfnissen, wie zum Beispiel dem Beruf. Auch Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand spielten eine Rolle. Die einzigen Lebensmittel, die nie rationiert wurden, waren Kartoffeln, Obst und Gemüse. Diese waren nötig für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Man versuchte deshalb, nicht komplett auf die spärlich vorhandenen Lebensmittel verzichten zu müssen. Man wollte vielmehr den Konsum verringern und mit Alternativen kombinieren. Doch nichtdestotrotz litten damals viele Menschen an einem Nährstoffmangel und Unterversorgung. Der Vitamin- und Mineralstoffmangel machte sie dementsprechend anfälliger für Krankheiten und schwächte den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung. Viele verloren eine Menge Gewicht und waren erschöpft, was in dieser Notsituation nicht optimal war, da jede Arbeitskraft und Unterstützung gebraucht wurde.
Diese Auswirkungen sind nicht schön, doch hätten die Folgen wahrscheinlich noch viel schlimmer ohne die Rationierungskarten ausgesehen. Die Karten hatten also einen bedeutenden Einfluss auf das Leben der Menschen in Baden. Sie mussten dadurch nicht nur lernen, sparsam mit gewissen Lebensmitteln umzugehen, sondern auch ihr Konsumverhalten ändern, neue Rezepte kochen und auch in Zeiten der Not zusammenhalten. Die Rationierungskarten veränderten deshalb das Leben in Baden und zeigt uns heute, wie wichtig bestimmte Lebensmittel für die Menschen damals waren.
Verdunkelungsvorhang (1939-1945)

Achtung die Bomber kommen!
Während des Zweiten Weltkrieges lebten die Menschen in Baden in Angst und Schrecken vor dem Krieg. Zwischen 1940 und 1945 wurden nämlich 77 Mal von den amerikanischen und britischen Fliegern Bomben über der Schweiz abgeworfen, meistens dachten die Piloten, sie befänden sich bereits über Deutschland. Doch dann kam die Rettung. Die Verdunkelungsvorhänge!
Über 6'500 Mal flogen alliierte Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg in den Schweizer Luftraum. Für die neutrale Schweiz war das sehr heikel, da man ihr vorwerfen könne, sie wäre nicht neutral, sondern würde die Angriffe der Alliierten unterstützen. Um also Verletzungen des Schweizer Luftraumes zu unterbinden und Bombenabwürfe über der Schweiz zu verhindern, führte der Bundesrat im November 1940 die Verdunkelung ein. Dafür musste man entweder die Lichter löschen oder Verdunkelungsvorhänge benutzen.
Im Historischen Museum Baden wird ein solcher Verdunkelungsvorhang aufbewahrt. Er hat eine Grösse von 140 auf 120 Zentimeter. Er diente einem Badener Haushalt für die Abschirmung von jeglichem Licht nach aussen. Die Verdunkelungsvorhänge bestanden in der Regel aus dicken, schweren Stoffen, die das Licht effektiv blockieren konnten. Oft wurden Materialien wie lichtundurchlässiger Baumwollstoff oder dicht gewebter Molton verwendet. Wenn dies nicht zur Verfügung stand, musste man kreativ werden und die Fenster zum Beispiel mit schwarzer Farbe oder Zeitungen abdunkeln.
Gerade für die Stadt Baden waren diese Verdunkelungsvorhänge essenziell, da sich Baden nur knapp 50 Kilometer Luftlinie von Deutschland befindet und die Alliierten ihre Flugrouten häufig über die Schweiz wählten, um nach Deutschland zu gelangen. Dies löste in Baden und vielen anderen Schweizer Städten, vor allem wenn diese nahe an der Grenze zu Deutschland lagen, Angst aus und das Verdunkeln wurde strikt kontrolliert.
Die Menschen empfanden diese Einschränkungen und Kontrollen teilweise aber als belastend und klagten, dass ihre persönlichen Freiheitsrechte dadurch eingeschränkt würden. Der Unmut und die Unzufriedenheit über die Geldstrafen und anderen Sanktionen bei Verstössen gegen die Verdunkelungsvorschriften nahmen zu. Einige argumentierten, dass die Sicherheit der Bevölkerung zwar wichtig sei, aber dass die Regierung zu weit gehe und die Bürgerrechte vernachlässige.
Der Einwohnergemeinderat Baden hatte schon 1936 die gesetzlichen Verordnungen der Verdunkelung des schweizerischen Bundesrats erhalten, im Hinblick auf einen möglichen Krieg zwischen Deutschland und den Alliierten. Daraufhin stellte der Gemeinderat einen Flyer für die Bevölkerung von Baden aus. Dieser enthielt nicht nur alle Massnahmen, sondern auch die „Strafbestimmungen“. Es wurde über die allgemeine Handhabung der Beleuchtung geschrieben, in Innenbereichen, im Freien und in Bezug auf Fahrzeuge. Zu Kriegsbeginn Ende 1939 traten diese Regelungen in Baden in Kraft.
Aber nicht nur diese Massnahmen machten der Bevölkerung von Baden zu schaffen. Auch die Lebensmittelrationierungen machten ihnen das Leben schwer. Da die Schweiz von allen Seiten umzingelt war, war sie auf sich allein gestellt und der Import von Waren in die Schweiz wurde stark reduziert. So wurde auch das Essen knapp und die Menschen mussten sparsam mit ihren Lebensmitteln umgehen. Die Nerven und die Geduld wurden hart auf die Probe gestellt, auch in schlaflosen Nächten.
Obwohl die Schweiz keine Kriegspartei war, forderten die Jahre des Zweiten Weltkrieges der Bevölkerung viel ab, denn man konnte nie wissen, was noch passieren würde. An den Schutzmassnahmen gab es zwar auch Kritik, aber im Rückblick steht der Verdunkelungsvorhang im Historischen Museum dafür, dass die Bevölkerung in die Verteidigung miteinbezogen war und zusammenhielt.
Endrit, Michael, Henrik, John
Rationierungscoupons von Laube & Gsell (1944-1945)
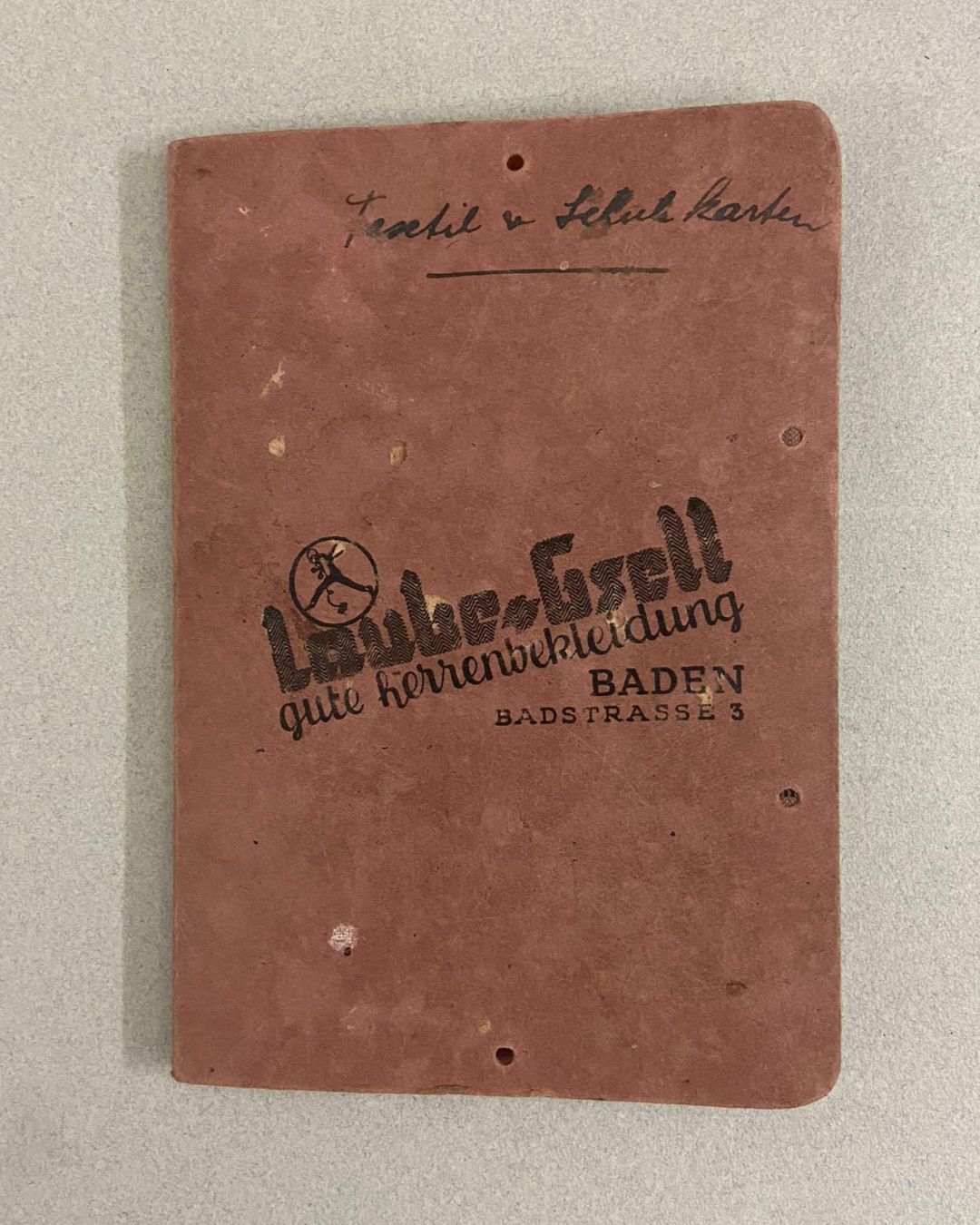
Die Rationierungscoupons von Laube & Gsell sind nicht nur irgendwelche Coupons, so wie man sie heutzutage erhält, um Güter billiger zu kaufen. Hinter diesem auf den ersten Blick scheinbar langweiligen Büchlein, steckt unglaublich viel Wissen und Bedeutung zu der damaligen Zeit, dem Zweiten Weltkrieg. Denn die Rationierungscoupons sind Zeitzeugen einer der schwierigsten Zeiten, welche die Stadt Baden im letzten Jahrhundert erlebt hatte. Sie geben uns einen Einblick in das alltägliche Leben der Menschen während diesen Jahren.
Die mit Stempeln und Unterschriften versehenen Rationskarten, waren für die Bewohner Badens im Zweiten Weltkrieg von entscheidender Bedeutung. Nach dem Ausbruch des Krieges am 1. September 1939, wurde klar, dass man das Leben, so wie man es kannte, nicht weiterführen konnte, denn die Nachfrage nach Gütern blieb gleich, doch da in den Nachbarländern der Schweiz Krieg herrschte, wurde zahlreiche Handelsrouten in die Schweiz abgeschnitten. Für diverse Güter wurde plötzlich das Angebot immer kleiner. Um die Nachfrage zu mindern, musste man Produkte rationieren.
Unter Rationierung versteht man die Zuteilung von beschränkt vorhandenen Gütern und Dienstleistungen in Notzeiten. Um beispielsweise, Lebensmittel, Kleidung und Brennstoff gerecht zu verteilen, wurde zu Rationierungscoupons gegriffen. Auf diesen Coupons stand, auf wie viel man von welchem Produkt, man Verfügung hatte. Diese Karten erhielt man an sogenannten Rationierungsstellen, in der Region Baden war das in Dättwil.
Für Baden war dieses System nicht neu. Schon 1914, während dem Ersten Weltkrieg kam die Rationierung in der Stadt zu ihrem Zug. Zu Beginn wurden Zucker, Fett, Öl, Hülsenfrüchte und Mehl begrenzt zur Verfügung gestellt. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr wurde aber rationiert. Schlussendlich rationierte man sogar noch Seife, Kohle, Benzin und Textilien.
Auch im Zweiten Weltkrieg wurden Lebensmittel rationiert. Wir haben uns aber mit den Textilrationierungscoupons von Laube & Gsell auseinandergesetzt. «Laube & Gsell» ist ein Mode und Detailhandel Laden in Baden, welcher 1922 von den Brüdern Laube gegründet worden ist. Nach der geschäftlichen Trennung der Brüder wurde Armin Gsell der neue Partner. Das Unternehmen hiess von nun an «Laube & Gsell». Sie ist mittlerweile 97 Jahre alt und existiert immer noch in Baden.
Mit den Rationierungskarten für Lebensmittel konnten Badener und Badenerinnen Essen kaufen. Menschen mit einem niedrigen Einkommen konnten also trotz vielen Coupons nicht viel Lebensmittel erwerben. Ähnlich war es mit den Rationierungscoupons von Laube & Gsell. Kleidung trug man zwar auch im Zweiten Weltkrieg, doch da das Geld sowieso knapp war, gab es bestimmte Bevölkerungsschichten, die sich eher Kleider leisten konnten. Je nach Beruf benötigte man auch mehr Kleidung bzw. die Kleidung, welche bei Laube & Gsell verkauft wurde.
Die Rationierungskarten erzählen also von mehr als nur von einer Zeit des Mangels und der Entbehrung. Sie spiegeln auch wider, was man damals für Kleidung getragen bzw. Essen gekauft hatte, und wie der Staat versuchte, für die Bevölkerung den Zugang zum Nötigsten zu gewährleisten. In den schweren Kriegszeiten war es notwendig, dass die Menschen zusammenblieben und sich gegenseitig unterstützten. Tauschgeschäfte, das Teilen von Ressourcen und das Finden kreativer Lösungen waren alltägliche Praktiken, um den Alltag zu bewältigen. Die Bevölkerung musste zwar nicht hungern, hatte aber auch nichts im Überfluss. Doch trotz den harten Zeiten waren die Menschen in der Schweiz friedlich gestimmt.
Diese Coupons erinnern uns daran, wie sich das Leben der Menschen in Baden während des Krieges radikal veränderte. Plötzlich mussten sie mit Einschränkungen und Knappheiten umgehen. Die Rationierungskarten aus Baden sind daher mehr als nur historische Dokumente. Sie sind Symbole für den Kampf und den Gemeinschaftssinn der Menschen in Zeiten der Not.
Luftgewehr (1945)

Während des Zweiten Weltkriegs spielten Gewehre, einschliesslich Luftgewehre, eine bedeutende Rolle in der Schweiz.
Das Luftgewehr, das im Venus-Waffenwerk Oskar Will in Zella-Mehlis hergestellt wurde, stellt ein interessantes Beispiel für die Vielfalt der Waffenproduktion in der Schweiz vor dem Zweiten Weltkrieg dar. Es hat ein Kaliber von 4,4 mm und einen Mehrlader mit Schüttmagazin. Trotz seiner relativen Schwäche in Bezug auf Mündungsenergie wurde es jedoch in den Beständen der Kadetten Baden von 1945 aufgeführt, was auf seine Bedeutung als Sammlerstück und Teil der militärischen Geschichte hinweist.
Luftgewehre wie diese hatten während des Zweiten Weltkriegs möglicherweise nicht die gleiche militärische Relevanz wie die üblichen Infanteriegewehre, aber sie hatten dennoch Einfluss auf die Schweizer Verteidigungsbemühungen. Sie dienten möglicherweise zur Ausbildung von Kadetten und zur Aufrechterhaltung der Schiessfähigkeiten der Bürgermiliz. Darüber hinaus könnten sie als Sicherheitswerkzeuge in bestimmten Kontexten genutzt worden sein, um beispielsweise potenzielle Eindringlinge abzuschrecken oder zu signalisieren.
Im Gegensatz zu anderen Ländern, war die Schweiz nicht direkt vom Krieg betroffen und blieb mehr oder weniger verschont. Nur selten schlugen kleinere Bomben auf die Schweiz ein. Doch auch die Schweiz war vom Krieg geprägt. Viele Menschen mussten jahrelangen Militärdienst absolvieren, es gab Versorgungsknappheit und vorrallem musste man ständig mit der Angst leben, von einem Nachbarsland angegriffen zu werden.
Die Mobilmachung begann am 28. August 1939, als 80'000 Mann für den Grenzschutz mobilisiert wurden. Am 1. September folgte dann der Aufruf zur allgemeinen Mobilmachung inkl. 430'000 Mann Kampftruppen und 200'000 Hilfsdienstpflichtige. Am 10. Mai 1940 verkündete der Bundesrat die zweite Mobilmachung. Rechtlich basierten diese Massnahmen auf der allgemeinen Wehrpflicht für Schweizer Männer. Diese wurde 1848 eingeführt.
Was hat das alles mit unserem Gewehr zu tun?
1874 wurde in der Militärorganisation die Schiesspflicht ausserhalb des Dienstes festgelegt. Die Schiessübungen wurden von Schützenvereinen durchgeführt. Fast an jedem Ort in der Schweiz wurden schrittweise Schützenstände gebildet. 1907 wurden jährliche Schiessübungen für alle Militärangehörigen eingeführt. In einem Kreisschreiben des Militärdepartements von 1908 wurde die Organisation des obligatorischen Schiessens an die Schützenvereine übertragen und die Mitgliedschaft der Wehrpflichtigen in einem Schützenverein festgelegt.
Die vom Militärdepartement im Jahr 1909 initiierten Jungschützenkurse wurden ebenfalls von den Schützenvereinen durchgeführt. Damit wurde eine Verbindung zwischen ziviler Staatsbürgerschaft und militärischer Schützenkultur hergestellt. Diese Verbindung hatte auch aufgrund der äusseren Bedrohung in den zwei Weltkriegen und der tatsächlichen Pflicht zur Mitgliedschaft in Schützenvereinen für fast ein Jahrhundert Bestand. Unser Gewehr wurde also mit ziemlicher Sicherheit in der Region Baden im Kontext der Mobilmachung verwendet.
Es spiegelt nicht nur die Vielfalt der Waffenproduktion in der Schweiz, einschliesslich Luftgewehren, wider, sondern auch die Vielseitigkeit der Schweizer Verteidigungsstrategie. Die Schweiz verliess sich nämlich nicht allein auf die damals üblichen Infanteriegewehre, sondern nutzte im Zweiten Weltkrieg verschiedene Arten von Waffen, um ihre Neutralität und Unabhängigkeit zu wahren.
So wurden Gewehre wie unser Luftgewehr während des Zweiten Weltkriegs zu Symbolen der Entschlossenheit und Selbstverteidigungsbereitschaft des schweizerischen Volkes. Die Tradition der Bürgermiliz und der allgemeinen Wehrpflicht wurde durch den Einsatz von Gewehren weiter gestärkt, was zeigte, dass die Schweiz auf einen möglichen Angriff vorbereitet gewesen wäre.
Das Luftgewehr aus dem Venus-Waffenwerk Oskar Will in Zella-Mehlis ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie selbst scheinbar weniger leistungsfähige Waffen einen Platz in der militärischen Geschichte und Verteidigung eines Landes einnehmen können.
Modellflug-Wanderpokal (1946)

Der Wanderflug-Modellpreis, den die Modellfluggruppe der BBC im Jahr 1946 erhielt, ist ein Symbol für die Geschichte, Leidenschaft und Innovation im Bereich des Modellflugs. Der Wanderpokal hat eine einzigartige Vogelform und gelblichen Farbe und wurde bereits im Jahr 1936 ins Leben gerufen. Jedes Detail dieses handgefertigten Pokals, von seinem 20 cm großen Umfang bis hin zu dem Metallschild in der Mitte, das die Namen der Gewinner präsentiert, erzählt eine Geschichte von Engagement und Exzellenz. Es ist ein Beweis für die handwerkliche Kunstfertigkeit und das Streben nach Perfektion, welches in der Schweiz sehr hoch geschätzt wird.
Wie und wo werden Wanderpokale denn verwendet? Wandertrophäen wandern bei jeder Meisterschaft zu einem neuen Gewinner. Bei sportlichen Wettkämpfen werden sie häufig als Anerkennung für den Sieger oder die siegreiche Mannschaft eines bestimmten Turniers oder Wettbewerbs in verschiedenen Sportarten wie Fussball, Golf, Tennis und vielen anderen verliehen. Auch bei Wettbewerben von Vereinen, Unternehmen oder anderen Organisationen werden sie eingesetzt sowie in kulturellen oder künstlerischen Kontexten, etwa bei Theaterwettbewerben oder Kunstausstellungen.
Die BBC hatte viele Organisationen für ihre Arbeiter. Die Modellfluggruppe war also nicht einzigartig, sondern relativ typisch für die Firmenkultur der BBC. Speziell hingegen ist die beeindruckende Reihe von Erfolgen im Modellflug der BBC. 1946 wurde die Modellfluggruppe BBC gegründet. Bis 1968 wurden als Mitglieder nur BBC Lehrlinge zugelassen. Nach dem Abschluss der Lehre mussten sie die Modellfluggruppe verlassen. Deshalb blieb die Mitgliedschaft relativ klein und wechselte auch oft.
Anfangs wurde noch in einem Schulzimmer der Lehrlingsabteilung an den Modellflugzeugen gewerkelt. 1947 stellte die Modellfluggruppe BBC bereits mit einem Hangsegelmodell einen schweizerischen Rekord auf, der bis heute gilt. Diese Pionierarbeit ebnete den Weg für weitere Errungenschaften, wie die erste Wettbewerbsteilnahme im Ausland im Jahr 1949 beim Wakefield-Trophy Contest in England, einem renommierten Wettbewerb für Gummimotormodelle. 1950 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Modellfluggruppe BBC mit der Einführung ihres ersten ferngesteuerten Segelflugmodells. Dieser technologische Fortschritt katapultierte die Gruppe 1951 zum Weltmeistertitel in der Motor-Freiflugmodellklasse in Paris. Von 1955 bis 1995 gewannen Mitglieder der Modellfluggruppe immer wieder Schweizermeisterschaften in verschiedenen Kategorien.
Derr Wanderflug-Modellpreis von 1946 ist also nicht nur ein Zeugnis der Innovationskraft und des Ehrgeizes der Modellfluggruppe Baden, sondern auch der Firmenkultur der BBC mit den Organisationen, welche es Lehrlingen sowie Arbeiterinnen und Arbeitern ermöglichte, sich in der Freizeit zu organisieren und zusammen an Wettkämpfen teilzunehmen. Solche Organisationen förderten sicher auch den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Organisationen wie die Modellfluggruppe Baden (BBC) nicht nur die Freizeit der BBC-Lehrlinge (und später der Arbeiterinnen und Arbeiter) prägten, sondern auch zur Wahrnehmung Badens ausserhalb der Stadt beitrugen.
Kleid mit Hut (1947)

Das 100-jährige Jubiläum der Spanischbrötlibahn war Anlass für die Badenfahrt 1947, um in Baden die Biedermeierzeit (ca. 1815-1848) wiederauferstehen zu lassen. Schaufenster wurden im Biedermeierstil dekoriert und Ehrengäste wurden von Frauen in Biedermeierkleidern betreut. Biedermeiermode sah man auch bei den Passagieren in der rekonstruierten Spanischbrötlibahn, am Kostümball im Kursaal, und natürlich an den Festzügen. Hunderte von Badenerinnen und Badener nähten oder kauften sich Biedermeierkleidung. Es soll von Fräcken und Reifröcken richtiggehend gewimmelt haben, schreibt ein Bericht von 1948. Doch wie korrekt waren denn diese Kostüme? Wir untersuchen ein Kleid mit Hut, das von Anni Müller-Meuli an der Badenfahrt 1947 getragen wurde, um das herauszufinden.
Anni Müller-Meuli (1912-2000) trug das Kleid an der Badenfahrt 1947. Ihr Mann arbeitete als Zahnarzt in der Praxis unter ihrer Wohnung, in welcher Müller-Meuli als Weissnäherin arbeitete. Müller-Meuli kam aus einer wohlhabenden Familie. Anni Müller-Meulis Kleidungsstil und ihre Persönlichkeit wurden von ihrer Tochter, Annalea Pasche-Müller, als elegant beschrieben. Dies passt sehr gut zu dem eleganten Kleid, welches sie 1947 an der Badenfahrt trug.
In der Biedermeierzeit wurden traditionelle Werte wie Familie und das häusliche Leben grossgeschrieben. Frauen aus dem Bürgertum trugen Kleider mit langen, glockenförmigen Röcken, enger Taille und ausladenden Schultern, die durch weite Ärmel verstärkt wurden. Kleider hatten Volants, Rüschen und Stickereien und florale Muster. Das für Anni Müller-Meuli genähte Kleid folgt dieser Mode bis ins Detail. Es besteht aus einem Korsett, welches mit weiten, voluminösen Ärmeln erweitert wurde. Mit Schulterpolstern, einem dicken Rock und einem Überrock bekam die Trägerin des Kleides die sogenannte «X-Form», welche in der Biedermeierzeit beliebt war. Heute kennen wir diese Form als «Sanduhrfigur». Das Kleid wurde mit einem schlichten Schultercape getragen. Cape, Korsett und Rock hatten ein florales Muster.
Zur Biedermeierzeit trugen Frauen in der Öffentlichkeit Hüte. Anni Müller-Meuli hatte sogar einen Hut und eine Haube für ihr Kostum. Der Hut ist gross und geht auf den Seiten und vorne in die Weite, ähnlich wie bei einem Cappy. Wir sind uns nicht sicher, weshalb sie einen Hut und eine Haube hatte, doch können wir uns vorstellen, dass sie während dem Umzug verschiedene Looks präsentieren wollte.
Anni Müller-Meulis Kleid wurde von der Schneiderin der Familie hergestellt. Eine wohlhabende Familie nähte ihre Kleidung damals nicht selbst. Die Schneiderin benutzte für das Kostüm Baumwolle und Seide aus dem Seidengeschäft «Seidenstoff-Fabrik-Union Adolf Grieder& Cie» in Zürich. Reine Seide war ein teurer und nur für die höheren Klassen erschwinglicher Stoff. Es war sozusagen ein Statussymbol: Wenn man ein Kleid aus Seide trug, gehörte man zu den wohlhabenden Familien. Dies galt für die Biedermeierzeit und 1947. Nur reiche Frauen wie Anni Müller-Meuli konnten es sich leisten, ein Seidenkleid nähen zu lassen, dass sie nur an einer Badenfahrt tragen würden.
Das Korsett hatte neben dem Hauptverschluss noch einen weiteren, kleineren Verschluss. Dieser sollte ein versehentliches Aufplatzen verhindern, was bei Seidenkleidung schnell passieren konnte. Anni Müller-Meuli trug ihr Kleid an den Badenfahrt-Umzügen. Dort war sie auch in Bewegung, was sicherlich sehr anstrengend in einem solchen Kleid war, denn eigentlich wurden diese Kleider ja von Frauen aus dem Bürgertum getragen, die sich nicht gross bewegen mussten, da sie Bedienstete hatten.
Alles in allem ist es der Schneiderin sehr gut gelungen, ein Kleid im Biedermeierstil zu nähen. Auch passte es zu Anni Müller-Meuli, da es ihre gesellschaftliche Klasse und ihre Persönlichkeit widerspiegelte.
Heute wird das Kleid mit den beiden Hüten im Historischen Museum Baden sicher aufbewahrt. Dafür werden professionelle Lagerungsmethoden verwendet. Das Kleid liegt in einem säurefreien Karton, damit die Farben nicht verloren geht und der Stoff keine Feuchtigkeit verliert. Was es wohl an der Badenfahrt 1947 alles erlebt hat?
Perücke (1947)

Bei unserem Twistory-Objekt handelt es sich um eine Perücke. Sie ist blond und hat links und rechts je einen Zopf mit einer roten Schleife. Das eher Suboptimale der ganzen Sache war, dass wir weder Informationen noch Herstellungsangaben zu ihr hatten. Da wir mithilfe der Perücke eine Badenfahrt untersuchen sollten, fragten wir uns: Wann hätte eine Badenerin solch eine Haartracht getragen haben können?
Schliesslich entdeckten wir die Badenfahrt 1947, an der sich Teilnehmerinnen im Biedermeierstil kleideten. Die Perücke sieht den Frisuren, die zur Biedermeierepoche Mode waren, sehr ähnlich. Deshalb vermuten wir, dass unsere Perücke von einer Dame, gepaart mit einem wunderschönen Biedermeierkleid, an der Badenfahrt 1947 getragen und somit auch um diese Zeit hergestellt wurde.
Die Biedermeierzeit war eine Epoche, die von 1815 bis 1848 andauerte. Sie entstand nach dem Wiener Kongress, bei dem das Volk sein politisches Mitspracherecht verlor, die Bürger sich deshalb zurückzogen und sich stark auf das private Leben fokussierten. Diese Zeit wurde auch in Baden von einem starken Bedürfnis nach Familie und der Sehnsucht nach heimischer Idylle geprägt.
Die Menschen wurden kreativer und liessen ihren Fähigkeiten freien Lauf. So entstanden einzigartige Gemälde, Kleider und Lieder. Auch Häuser wurden damals gebaut, deren Bauart man noch heute in der kleinen Badener Altstadt bewundern kann!
1947 fand eine Badenfahrt statt, die an diese Zeit zurückerinnern sollte. Sie feierte das 100-jährige Jubiläum der Spanischbrötlibahn, die am 9. August 1847 zum ersten Mal in Gang gesetzt worden war und somit den öffentlichen Verkehr und den Tourismus in Baden revolutionierte. Menschen kamen aus allen Ecken der Schweiz, um an dieser Badenfahrt teilzunehmen. Die Freude dieser Besucher war sicher gross, aber die der Badenerinnen und Badener war noch grösser. Dies zeigte sich an der Mühe, die sie sich gaben. Alles sollte perfekt biedermeierlich, also wie vor 100 Jahren, aussehen. Ladenbesitzer schmückten bis kurz vor Beginn der Badenfahrt noch ihre Schaufenster. Man fuhr mit alten Kutschen umher und die Kleidung, wie wir an unserer Perücke sehen können, kam auch nicht zu kurz. Die Badener trugen vom Biedermeier inspirierte Anzüge mit Zylinder und die Badenerinnen kleideten sich in voluminösen Kleidern und eleganten Perücken, die mit Schleifen und Blüten bestückt waren. Wir gehen davon aus, dass unsere Perücke aus Kunsthaar besteht, da sich Kunsthaar zwar nicht so lange hält und schnell verfilzen kann, aber erschwinglicher ist als Echthaar.
Vor allem wegen dem Zweiten Weltkrieg und den wirtschaftlichen Krisen, unter denen 1947 Europa litt, denken wir, dass die Badener ihr Geld für ihren Lebensunterhalt benötigten und sich über die billigere, aber trotzdem noch authentische Perücke sicher freuten. Auch für ein richtig authentisches Kleid reichte das Geld bei vielen damals nicht. Biedermeierkleider gab es vermutlich in keinem Geschäft mehr zu kaufen. Man musste also einer Schneiderin ein biedermeier-inspiriertes Kleid in Auftrag geben. So ein Auftrag kostete Unmengen an Geld, das viele nicht besassen.
Doch die Badener Zeitungen von 1947 hatten einige alternative Vorschläge. Sie erklärten, wie man an biedermeierliche Kleidungsstücke kommen konnte. So ermunterten sie ihre Leserinnen, in Grossmutters alter Kleiderkiste zu graben und sich die richtig alt aussehenden Kleider auszuleihen, oder sich wie die damalige Unterschicht zu verkleiden. Dafür brauchte man nämlich nur ein weisses Bettlaken, eine Schere, um ein Loch für den Kopf in das Laken zu schneiden, und einen Gürtel, der das Gewand zusammenhielt.
Für die Badenfahrt betrieben die Badener dann aber doch viel mehr Aufwand, um die Biedermeierzeit mithilfe der Kleidung und der Gestaltung des Geländes so realitätsnah wie möglich darzustellen. Wir sind uns sicher, dass die Badener auf die Badenfahrt 1947 besonders stolz waren. Sie konnten zeigen, was ihr kleines Städtchen in der Vergangenheit schon alles geleistet hatte und was für einen grossen Einfluss es auf die Entwicklung der Schweiz hatte. Ausserdem hatte endlich jeder Besucher und jede Besucherin die Möglichkeit, die politischen Unruhen und den gerade erst gewesenen zweiten Weltkrieg für einige Tage zu vergessen und mit Freunden und Familie zu feiern.
Heute, 2023, genau 76 Jahre nach der Badenfahrt 1947, ist unsere Perücke in einem abgenutzten Zustand und wird nicht mehr zu besonderen Anlässen getragen. Aber sie erinnert an eine Zeit, die längst vergangen, aber nicht vergessen ist. Sie erzählt eine Geschichte und ist ein Teil der Vergangenheit Badens.
Sarah, Enna, Jessie und Suela
Informationstafel (1960-1987)
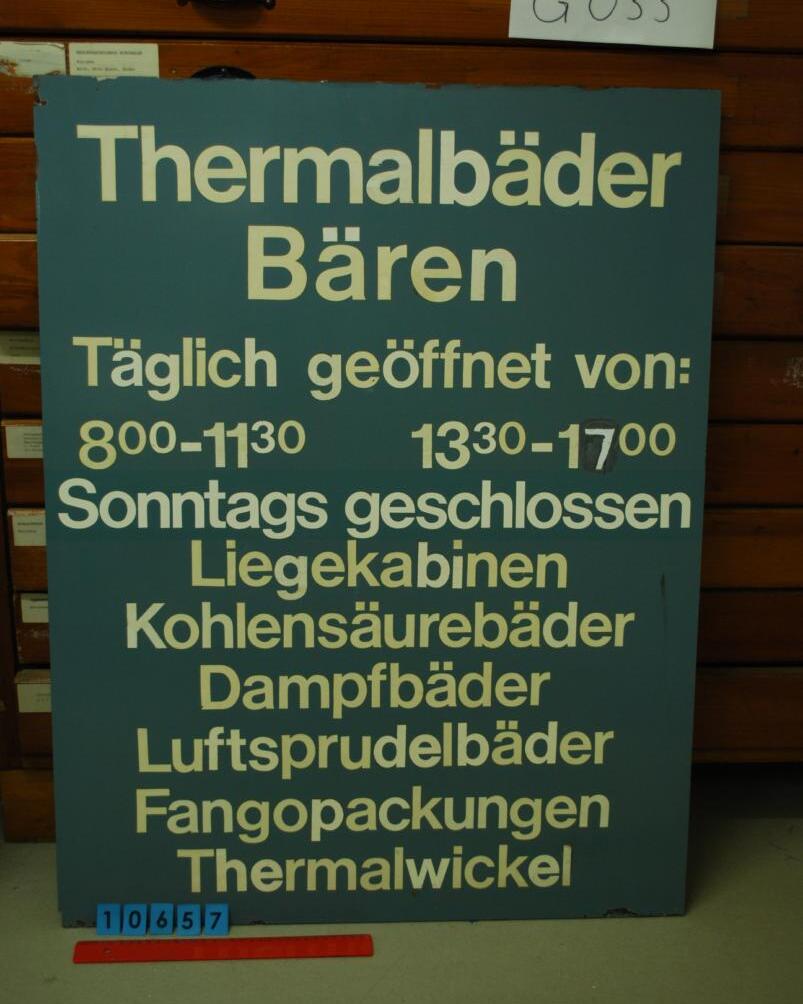
1361 wurde das Hotel Bären zum ersten Mal als Badehaus erwähnt und entwickelte sich zu einem angesehenen Hotel im Bäderquartier von Baden, welches vor allem durch seine hauseigenen Quellen Kurgäste ansprach. Unser Objekt ist eine Informationstafel des Hotel Bären, die zwischen 1960 und 1987 benutzt wurde. Während dieser Zeit war die Informationstafel eine wichtige Anlaufstelle für Badener Kurgäste und das wortwörtliche Aushängeschild des Hotels.
Als das Hotel 1987 von der Verenahof AG aufgekauft wurde, beschloss die Aktiengesellschaft, den für nicht mehr rentabel gehaltenen Hotelbetrieb einzustellen. Die Tafel kam deshalb nach dem Liquidationsverkauf Anfang November desselben Jahres in den Besitz einer unbekannten Privatperson. Gemeinsam mit weiteren Objekten aus dem ehemaligen Hotel Bären fand die Tafel aber schliesslich ihren Weg als Schenkung zum Historischen Museum Baden. Seit 2016 ist die Informationstafel ein Teil der Sammlungswand im ersten Untergeschoss des Historischen Museum Baden.
Mit der Informationstafel haben sich die damaligen Besitzer des Hotel Bären vermutlich erhofft, mehr Besucher anziehen zu können. Informationstafeln sind eine gängige Methode, um den Besuchern von Sehenswürdigkeiten oder Naturschutzgebieten interessante Fakten, Geschichten oder Wegbeschreibungen zu präsentieren. Die Gestaltung soll die Betrachtenden zu genauerem Hinschauen ermuntern.
Der «Bären» nutzte die graublau grundierte Glastafel mit weissen Klebebuchstaben zur Bekanntmachung der Öffnungszeiten der Thermalbäder des Hotels und der zahlreichen unterschiedlichen Angebote. Wahrscheinlich war die Informationstafel essenziell im Konkurrenzkampf des Hotel Bären gegen die vielen umliegenden Gasthöfe. Direkte Nachbarn des Hotel Bären waren nämlich zwei weitere bekannte Hotels: der Verenahof und das Hotel Ochsen. Doch leider konnten diese Bemühungen am Ende das Hotel Bären nicht vor der Schliessung retten.
Unser Objekt wurde rund 15 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ein Teil des Badener Hotels. In der Nachkriegszeit gerieten die Badener Bäder in eine enorme Krise, da der Kurort seine Attraktivität als Urlaubsdestination verloren hatte. Grund dafür war, dass Kuraufenthalte nun in der Gesellschaft als Inbegriff von Alter und Krankheit angesehen wurden. Zudem führten die veralteten Einrichtungen im Bäderquartier und der Mangel an Investitionen zu weiteren Problemen.
Mit dem Aufstellen der Informationstafel tätigte der damalige Besitzer des Bären eine Investition für sein Hotel, um hoffentlich mehr Besucher anziehen zu können. Über die Zeit, in der die Tafel genutzt wurde, konnten wir keine Informationen zur Tafel finden, ausser, dass sie Schäden davongetragen hat. Die Farbe an den Rändern fing an abzusplittern, die Klebebuchstaben der Beschriftung fingen an, sich gelblich zu verfärben und bei der Zahl «7» und der Zeile «Sonntags geschlossen» musste eine Revision vorgenommen werden.
Heute benötigt das Hotel Bären keine Informationstafel mehr, denn seit der Schliessung des Hotels 1987 wurde es nie wiedereröffnet. Pläne für ein grosses Thermalbad scheiterten, doch seit 2009 läuft ein neues Projekt. Das Hotel soll verbunden mit seinen benachbarten Hotels zu einer Rehabilitationsklinik umgebaut werden. Diese Klinik sollte ursprünglich gleichzeitig mit dem “Fortyseven“ eröffnet werden. Doch der Umbau geriet durch Erhöhung der Gesamtkosten um CHF 15 Millionen in Verzögerung und ist bis heute noch nicht vollendet. Der Plan wäre es, den Bau Ende 2023 abzuschliessen.
Mia, Julie, Hayley und Katja
Thermalschwimmbad-Schild (1965)

Im Historischen Museum Baden liegt im Depot auf einem Regal ein unscheinbarer Wegweiser aus dem Jahr 1965, der auf der Rückseite mit den Namen verschiedenster Hotels beschriftet ist. Nach viel klingt das nicht, doch bei genauerem Hinsehen und Recherchieren stösst man auf spannende Fakten über die Bädergeschichte Badens.
Wegweiser sind aus unserer Gesellschaft kaum mehr wegzudenken, obwohl wir im Alltag meistens das Handy benützen. Mit nur zwei Klicks kann man den gewünschten Standort eintippen und prompt ist man vor Ort. Doch in den 1960er Jahren war dies nicht so leicht. Die Bevölkerung war auf Richtungsanzeiger angewiesen. Vor allem in einer so vom Tourismus geprägten Stadt wie Baden, gab es immer viele Leute, die sich nicht in der Stadt auskannten. Wegweiser waren für sie wichtig, damit sie sich orientieren konnten.
Baden profitiert bis heute stark vom Tourismus. Seit Beginn der Bädergeschichte wurden viele Besucher und Besucherinnen von den berühmten Quellen und Thermen Badens angelockt und statteten dem Bäderquartier den einen oder anderen Besuch ab. Doch wer entdeckte die Badener Quellen überhaupt und wie wurde Baden als Bäderstadt bekannt?
Dafür ist eine grössere Zeitreise zurück in die Zeit der Römer nötig. Damals wurde Baden «Aquae Helveticae» genannt, was so viel wie «Wässer Helvetiens» bedeutet.
In der Römischen Kultur nahm die Körperhygiene und das Baden einen hohen Stellenwert ein. Thermen waren fester Bestandteil Römischer Städte. Während in den meisten Thermen Sklaven das Wasser mit Feuer wärmen mussten, gab es in Baden heisse Quellen. Als sich das Römische Militär in Vindonissa installierte, wurden die Römer und Römerinnen auf die 47 Grad heissen Quellen in der Umgebung aufmerksam und so wurden in Baden zu Beginn des ersten Jahrhunderts die ersten Thermen errichtet.
Das Gebiet rund um «Aquae Helveticae» wurde zum perfekten Rückzugsort für Römerinnen und Römer, die zwischen Gallien, Germanien und Italien unterwegs waren. Dem Thermalwasser wurden auch heilende Kräfte zugesprochen, weshalb in der Folge Menschen von überall ins heutige «Baden» reisten. Auf den Namen der Stadt kam man also aufgrund der berühmten Bäder, denn in «Baden» war man, um zu Baden.
Die Bäderstadt wurde schnell zum Wirtschafts- und Handelszentrum der Region. Die Beliebtheit der Badener Thermen bei Touristen führte im Spätmittelalter zu der sogenannten «Badenfahrt». Damit wurden Schiffsreisen von Kurgästen auf der Limmat von Zürich nach Baden bezeichnet. Die Aufenthalte der Kurgäste waren aber nicht nur rein medizinischer Natur; schon bald wurde mit dem Ausdruck «Badenfahrt» auch das Feiern und Vergnügen in Baden bezeichnet. Ab dem 18. Jahrhundert wurden im sogenannten Bäderquartier immer mehr Hotels gebaut, und ab 1847 konnten Gäste sogar bequem mit der Spanisch-Brötli-Bahn nach Baden reisen. Man ging zwar nach Baden um zu baden, aber auch um es sich gut gehen zu lassen. Das erklärt, weshalb im 20. Jahrhundert ein Badener Volksfest unter demselben Namen organisiert wurde.
Vor genau hundert Jahren nahm die heute schweizweit bekannte Tradition eines der grössten Feste der Schweiz ihren Lauf. Die erste Badenfahrt von 1923 sollte an den Friedenskongress von 1714 erinnern. Der Name des Festes verweist aber auf die Geschichte Badens als Kurort. Seit 1923 findet die Badenfahrt alle fünf bis zehn Jahre mit immer neuen Themen statt. Über eine Million Besucher und Besucherinnen nehmen am Fest teil.
Badener Hotels und Thermen sind heute wieder gut besucht. Das war aber nicht immer so: Nach den beiden Weltkriegen blieben in Baden die Gäste und Einnahmen aus. In den 1960er Jahren wurde mit Hotelneubauten versucht, den Rückstand aufzuholen. Unser Wegweiser stammt aus dieser Zeit. Er zeigt den Touristen den Weg zum Thermalschwimmbad und zu verschiedenen Hotels. Die Badenfahrt von 1967 mit ihrem Thema «Räder machen Leute» wollte die ursprüngliche Verbindung von Badekur und Vergnügen in Baden wieder aufleben lassen. Leider war dies nicht erfolgreich – die Gäste blieben aus. Zahlreiche Hotels mussten in den folgenden Jahrzehnten ihre Türen schliessen und der Wegweiser endete als Sammlungsobjekt im Historischen Museum Baden. Die Badenfahrt aber ist bis heute ein riesiges Volksfest geblieben, welches aus der Schweizer Geschichte nicht mehr wegzudenken ist.
Medea, Elena, Hana und Noée
Müllerbräu Flasche (1967)
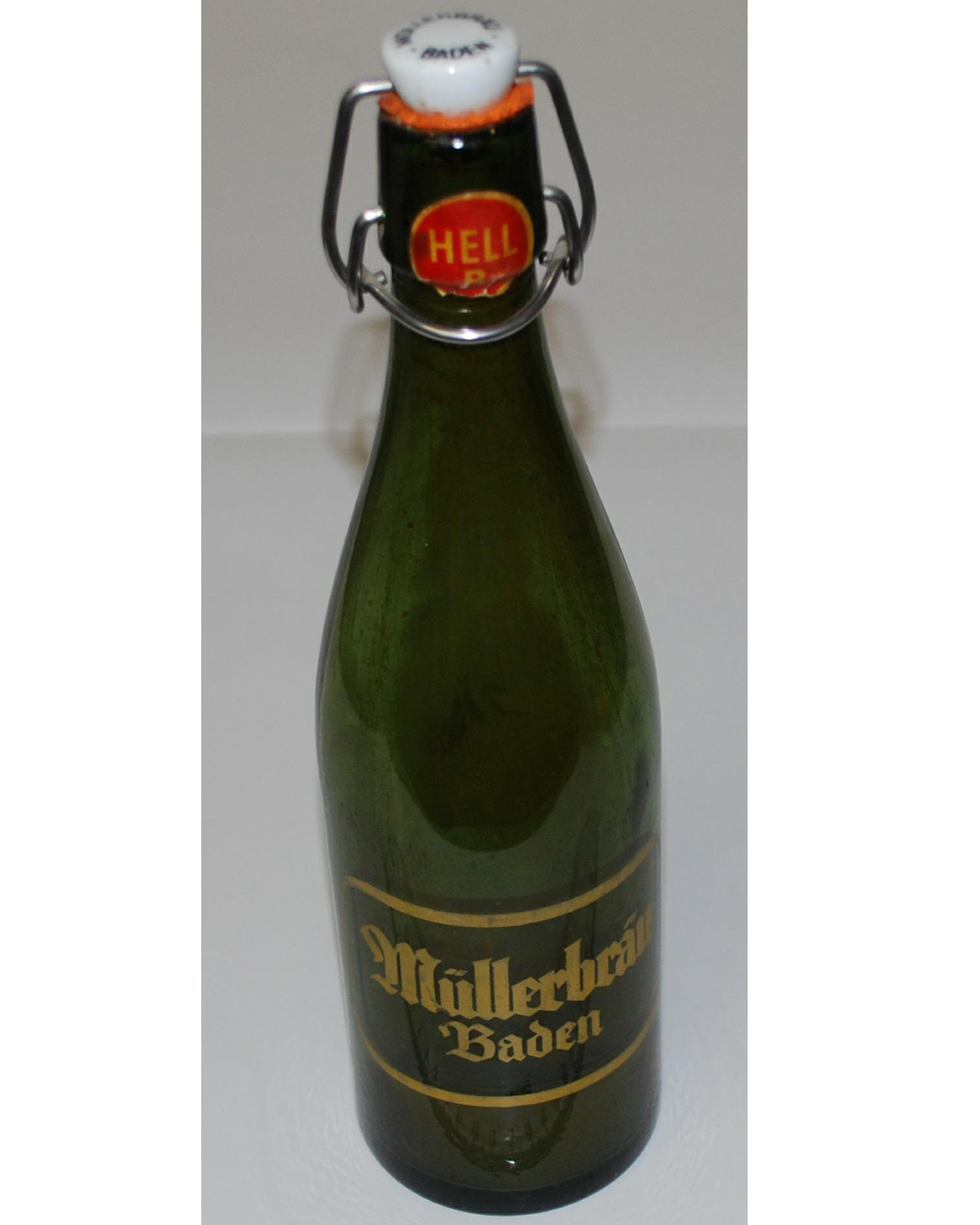
Eine Müllerbräu Bierflasche aus dem Historischen Museum Baden bewog uns, Alkohol an der Badenfahrt genauer anzuschauen.
Die 1897 gegründete Badener Brauerei Müllerbräu arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Badenfahrt zusammen. An der Badenfahrt 2017 stellte die Firma Müllerbräu bis zu 3000 Hektoliter an Bier bereit. Auch dieses Jahr wird die Badenfahrt nicht ohne die Brauerei stattfinden.
An der Badenfahrt wird sehr viel Alkohol, besonders Bier, konsumiert, was natürlich ein Vorteil für Müllerbräu ist. Für die Firma ergibt sich jedoch kein Riesengewinn aus dem Verkauf alleine. «Wenn alles rund läuft und das Wetter mitspielt, dann schauen am Ende des Festes ein paar 10000 Franken raus.» Das sagt Müllerbräuchef Felix Meier im Interview. Es sei sicher nicht so, dass man an der Badenfahrt 20 bis 30 Prozent des Jahresumsatzes erziele.
Dass der Gewinn nicht sonderlich hoch für die Zahlen ist, hat aber noch einen anderen Grund: Der Sponsoringvertrag mit dem Badenfahrt-OK beinhaltet, dass Müllerbräu für die ganze Getränkelogistik verantwortlich ist. 700 Kühlschränke, 160 Durchlaufkühler und 180 Buffets werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die Badenfahrt zahlt sich aber für Müllerbräu insofern aus, dass der Kontakt zum Volk und dadurch auch ein enormer Werbefaktor hergestellt wird. Wie man auch heute sieht, gibt es sowohl Plakate, wie auch ganze Bus-Designs, welche gross für die Badenfahrt werben. Immer gross mit dabei: Müllerbräu. Aufgrund dieses Werbefaktors stellt sich die Frage, ob man damit nicht auch den Alkoholkonsum stärkt.
In einem Interview mit dem Müllerbräu Geschäftsleiter Felix Meier haben wir erfahren, dass dies keine Sorge für ihn ist. Im Mittelpunkt der Badenfahrt steht das Zusammenbringen der Menschen, egal ob sie aus Baden kommen oder ob sie für die Badenfahrt weite Wege auf sich nehmen. Für diese gesellschaftliche Durchmischung sei Bier einfach essenziell, sagt Felix Meier. Wer in vernünftigen Massen konsumiere, habe eine gute Voraussetzung auf eine großartige Badenfahrt. Eine Badenfahrt ohne Bier und somit auch Müllerbräu sei einfach unvorstellbar, da das Trinken eines Bieres mit seinen Mitmenschen zu einem Teil der Badenfahrt geworden sei.
Jedoch sollte der eigentliche Sinn der Badenfahrt nicht vergessen werden, eine kulturelle Veranstaltung, welche zu einer geliebten Badener Tradition und sogar der Schweizer Bevölkerung geworden ist.
Für den Konzern Müllerbräu ist die Badenfahrt ein aufwendiger Anlass. Entsprechend früh wird mit der Planung angefangen und natürlich wird auch viel Bier gebraut. Faktoren wie das Wetter oder die Besucherzahlen beeinflussen die Verkaufszahlen stark, diese kann man jedoch nicht garantiert voraussagen. Für Müllerbräu steht deshalb viel auf dem Spiel, jedoch wurde bis jetzt kein grosser Verlust gemacht. Felix Meier rechnet mit einem Absatz von rund 1500 Hektorlitern Bier. Etwa die Hälfte Offen-Bier und die andere Hälfte Dosenbier (150 000 Dosen). Dazu noch hat es noch eine Reserve von 500 Hektolitern in Fässern und 30 000 Bierdosen.
In unserer Arbeit beschäftigen wir uns auch mit dem Alkoholkonsum an der Badenfahrt und wie dieser durch die Badenfahrt dargestellt wird. Felix Meier sagte, dass die Werbung nicht den Alkoholkonsum steigern soll, sondern die Bekanntheit der Produkte. Müllerbräu unterstütze keinen übermässigen Alkoholkonsum. Das Organisationskomitee der Badenfahrt vertritt die gleiche Stellung und argumentiert, eine komplette Abschaffung von Alkohol käme nicht in Frage. Jedoch schätzen auch sie ein friedliches Verlaufen des Festes und finden, dass massloser Alkoholkonsum nicht an die Badenfahrt gehört.
Durch den steigenden Alkoholkonsum nimmt nämlich die Anzahl der Massnahmen, welche für eine sichere und friedliche Badenfahrt sorgen, stark zu. Dadurch steigen auch die Ausgaben der Badenfahrt, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Einige Menschen kennen ihr eigenes Alkohollimit nicht oder konsumieren absichtlich in zu grossen Mengen.
Trotz der tiefen Anzahl an gemeldeten Vorfällen, musste an der Badenfahrt 2017 die Polizei einige Male einschreiten. Am ersten Fest-Wochenende gab es 23 Hospitalisierungen, 2 Flussrettungen und 287 Bagatellvorfälle. Auch einige Lärmmeldungen gab es, weshalb an der diesjährigen Badenfahrt strenge Regeln bei der Lautstärkeregulierungvon Beizen herrschen.
Unsere Bierflasche ist somit ein Zeichen der Relevanz und des Zusammenhanges von Bier bzw. Alkohol und der Badenfahrt. Sowohl heute, wie auch zukünftig, wird Müllerbräu stets ein essenzieller Teil der Badenfahrt bleiben - als Lieferant, aber auch als Beitragende zum gesellschaftlichen Aspekt der Badenfahrt.
Jasmin, Luca und Gabriel
Nastuch (1971)

Das Nastuch - ein Objekt, das so unscheinbar wirkt und dennoch eine so spannende Geschichte mit sich trägt. Diese Geschichte wollten wir ergründen, als wir das Objekt zum ersten Mal im Historischen Museum Baden sahen. Genauer gesagt waren es 14 quadratische Nastücher, die in der Mitte das Ennentbadener Wappen aufgedruckt haben. Über dem Wappen ist das Datum 1. Juli 1971 festgehalten. Unter dem Wappen steht die Beschriftung: „Zur Erinnerung an den ersten Gemeindeversammlungsbesuch der Frauen – Der Gemeinderat Ennetbaden“.
Doch was hat es mit dieser Beschriftung genau auf sich?
Am 1. Juli 1971 erhielten die ersten Frauen, die an der Ennetbadener Gemeindeversammlung teilnahmen, als Souvenir Nastücher geschenkt, die an das Frauenstimmrecht erinnern sollten. Eine Geste, die so auch in anderen Orten der Schweiz beschrieben wurde.
Aber wie sah das „Frauenstimmrecht“ zu jener Zeit in Baden aus und was trug die Stadt an der Limmat dazu bei?
Bei unserer Recherche zu den Nastüchern stiessen wir auf eine Handvoll von Informationen, die die Entwicklung der feministischen Politik in Baden aufzeigen. Die vergleichsweise kleine Stadt Baden kann viele Frauenverbände, eine hohe politische Zustimmung sowie zahlreiche Schlüsselpersönlichkeiten vorweisen, die den Weg zur Gleichberechtigung ebneten. Zu den wichtigen Persönlichkeiten darf die Stadt Baden Frauen wie Anne Marie Höchli, Präsidentin des Frauenbunds Baden, oder die „Papa Moll“ Erfinderin Edith Oppenheim-Jonas zählen, die sich gemeinsam mit einer Mischung aus politischem Engagement und künstlerischem Einsatz für das Frauenstimmrecht einsetzten.
Natürlich war nicht nur die Stadt Baden in feministische Bewegungen involviert. Engagiertere Organisationen, wie beispielsweise die Züricher Frauenbefreiungsbewegung (FBB), spielten eine wichtige Rolle bei dieser politischen Bewegung. Oftmals bestanden diese Vereine auch aus Mitgliedern umliegender Städte – so auch aus Badener Feministinnen, die ihre Anliegen in die einflussreichere Grossstadt Zürich tragen wollten.
Isabella, Octavia, Philipp
Tuch (1971)
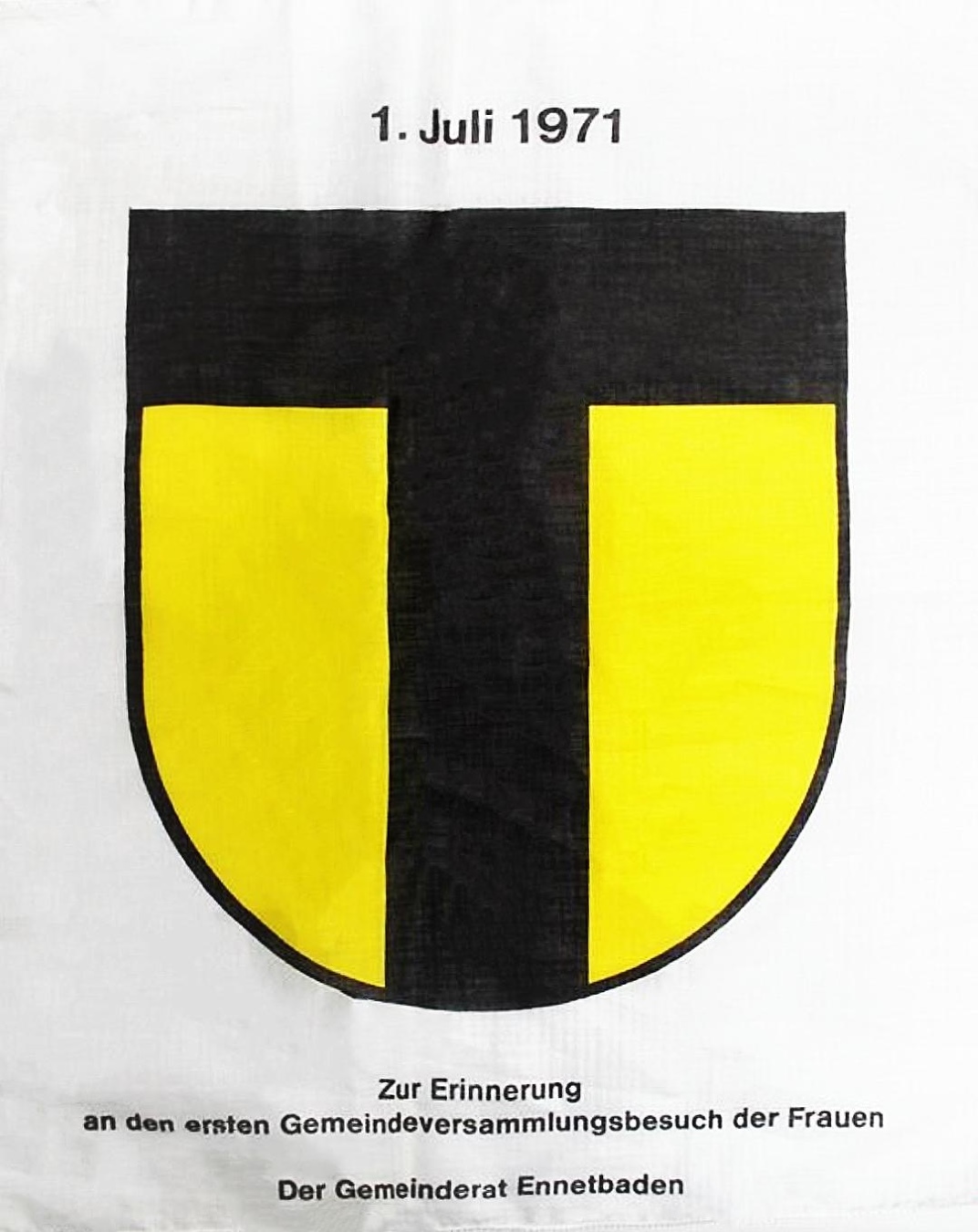
Ein quadratisches weisses Tuch mit dem Ennetbadener Wappen und einem Widmungstext liegt in Baden im historischen Museum. Am 1. Juli 1971 hat die Bevölkerung von Ennetbaden dieses Tuch oder eher diese Tücher, denn heute gibt es noch 14 Exemplare davon, das erste Mal erblickt. Die erste Gemeindeversammlung, an der Frauen teilnehmen durften, fand statt. Doch zurück zum Anfang.
Bereits im 19. Jahrhundert gab es in der Schweiz eine Frauenbewegung, welche das Frauenstimmrecht forderte. Doch diese Bewegung hatte mit sehr vielen Rückschlägen zu kämpfen. Über 100 Jahre
kämpften verschiedene Frauenverbände, Gemeinschaften und sogar Parteien für die Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts. Am 7. Februar 1971 hatten sie es endlich geschafft. Zwölf Jahre zuvor
hatte sich das Schweizer Stimmvolk noch gegen das Frauenstimm- und Wahlrecht ausgesprochen. Auch wenn viele der WegbereiterInnen von damals es nicht mehr miterleben sollten, wurde die Vorlage zur
Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts in der Schweiz nun endlich angenommen.
Für die Ennetbadener Frauen bedeutete dies, dass sie nun auch am politischen Geschehen teilnehmen konnten. Knapp fünf Monate später, am 1 Juli 1971, fand in Ennetbaden die erste
Gemeindeversammlung statt, an welcher auch die Frauen teilnehmen durften. Diese erschienen auch sehr zahlreich zur Versammlung.
Der Gemeinderat wollte die Frauen mit etwas speziellem willkommen
heissen. Er wusste nur noch nicht genau womit. Er entschied sich schliesslich für Taschentücher. Diese sollten in der Mitte gross das Ennetbadener Wappen aufgedruckt haben, welches aus einem schwarzen
«T» auf gelbem Grund besteht. Zusätzlich sollten sie mit dem Datum der Gemeindeversammlung versehen werden, sowie mit dem folgenden Widmungstext: «Zur Erinnerung an den ersten Gemeindeversammlungsbesuch der Frauen – Der Gemeinderat Ennetbaden».
Im Gemeinderatsprotokoll wurde festgehalten, dass der Gemeinderat den Frauen keine Blumen als Präsent überreichen wollte, da dies einem zu konservativen Klischee folgen würde. Dies war auch im Sinne eines Ausspruches von Christian Morgenstern: «Ich habe heute ein paar Blumen nicht gepflückt, um dir ihr Leben mitzubringen.»
Weshalb sich der Gemeinderat für Tücher als Präsent für die Frauen entschieden hatte, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit sagen. Eine Interpretation ist, dass der Gemeinderat wollte, dass sich die
Frauen die Freudentränen abwischen können. Eine andere Interpretation besagt, dass sie die Tränen abwischen können, falls die Politik zu belastend für sie ist. Wie dem auch sei, es gab für alle politischen
Richtungen eine passende Interpretation.
Abschliessend lässt sich festhalten, dass das quadratische weisse Tuch mit dem Ennetbadener Wappen und dem Widmungstext nicht nur ein simples Geschenk war, sondern eine tiefe symbolische
Bedeutung trug. Es repräsentierte den historischen Moment, in dem die Frauen von Ennetbaden erstmals an einer Gemeindeversammlung teilnehmen durften und damit politisch teilhaben konnten.
Das Tuch war ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung seitens des Gemeinderats und stand für den Fortschritt in Richtung Geschlechtergleichstellung und politischer Partizipation. Es erinnerte
nicht nur an diesen besonderen Tag, sondern auch an die langen Jahre des Kampfes und an die Bemühungen, die letztendlich zur Einführung des Frauenstimm- und Wahlrechts führten. Die 14
Exemplare dieses symbolträchtigen Tuchs im historischen Museum von Baden, dienen als Erinnerung an einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Frauenrechte im Aargau.
Badenfahrtplakat «Nixe» (1977)
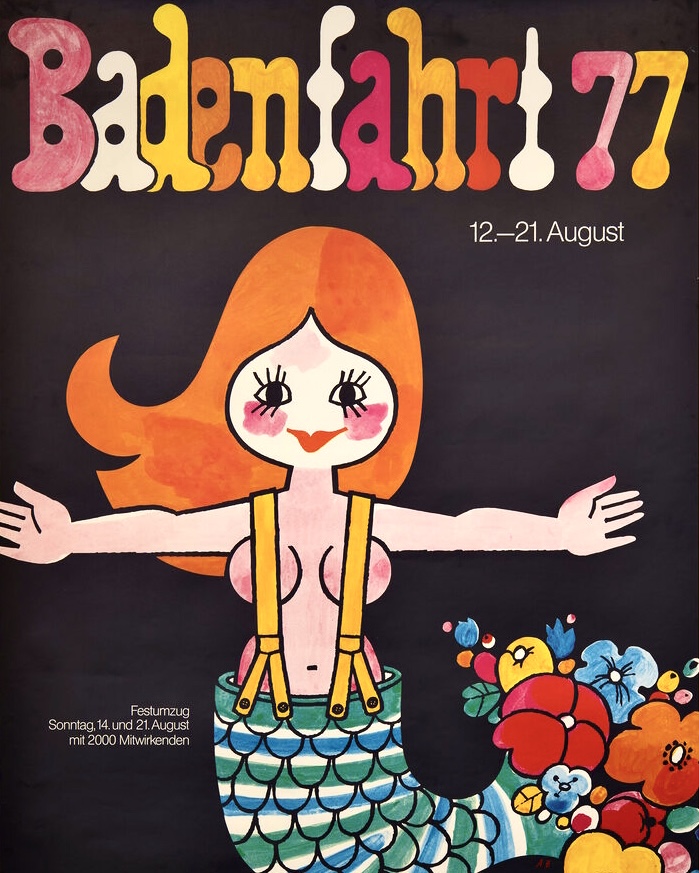
Ein Plakat verrät in seinen Details Werte und Ansichten der Gesellschaft aus der Zeit seines Ursprungs. Das Wassernixen-Plakat der Badenfahrt 1977 zieht mit seinen auffälligen Farben und Motiven Blicke auf sich. So auffällig das Plakat ist, so wirft es auch einige Fragen auf. Wie hatte die damalige Gesellschaft das Plakat empfunden? Wurde Kritik geäussert wegen der unübersehbaren Darstellung der freizügigen Wassernixe? Weshalb wurde überhaupt eine Wassernixe als Motiv für die Badenfahrt 1977 gewählt?
Der Leitgedanke, der die Wassernixe 1977 zum Motiv des Badenfahrt-Plakates machte, ist auf das Motto der damaligen Badenfahrt zurückzuführen: «Im Wasser sind zwoi Liebi». Damit sollte auf die Verbindung zwischen Baden und Wasser hingewiesen werden.
Diese Verbindung wurde auch in einem an der Badenfahrt 1977 aufgeführten Theaterstück klar, welches den Ursprung der Badener Heilquellen anhand der Sage von Ethelfrida und Siegawyn erzählte. Es handelte davon, dass Siegwyn, der Anführer eines Helvetierstammes, und seine Geliebte, die Druidentochter Ethelfrieda, zurückblieben, als es Zeit für die Helvetier wurde, aufzubrechen und weiterzuziehen. Ethelfrieda war schwer krank und wurde von Tag zu Tag schwächer. Als daraufhin die Nahrungsquelle des Paares, ihre Ziege, verschwand, ruhte Siegawyn nicht, bis er sie bei einer heissen Quelle fand. Siegawyn entdeckte die heilenden Kräfte dieses Wassers und badete Ethelfrieda darin jeden Tag, bis sie wieder komplett genesen war.
«Im Wasser sind zwoi Liebi» führte also dazu, dass das Organisationskomitee die Wassernixe als Motiv der Badenfahrt 1977 wählte. Man fand sie nicht nur auf Plakaten, sondern auch auf vielen weiteren Gegenständen wie Shotgläsern, Medaillen, Postkarten, T-Shirts und ähnlichen Festartikeln, welche damals als Werbeartikel genutzt wurden.
In der Schweiz entwickelte sich die Plakatindustrie Ende des 19. Jahrhunderts mit der Lithografie, einer Drucktechnik. Plakate waren eines der wichtigsten Instrumente, um die Mehrheit der Bevölkerung zu informieren bzw. zu beeinflussen. Zur Zeit des Nixenplakats wurde mit Plakaten für Filme, Theateraufführungen, Konzerte und Feste geworben.
In den 1960er und 1970er Jahren wurden Plakate auch provokativer und es wurden vermehrt geschlechterdiskriminierende und sexualisierte Motive benutzt. Das Wassernixenplakat wiederspiegelt diesen Trend.
Zu dieser Zeit feierten Frauenbewegungen im In- und Ausland grosse Erfolge und hinterfragten die traditionellen Geschlechterrollen. Frauen protestierten u.a. dagegen, dass die Frau als Lust- und Prestigeobjekt in der Gesellschaft dargestellt wurde. Wir fragten uns deshalb, welche Werbestrategie hinter dem Nixenplakat steckte und ob es auch von den sozialen Veränderungen beeinflusst wurde.
In einem Interview mit Sepp Schmid, einem Mitglied des damaligen Badenfahrt-Komitees, erfuhren wir die beabsichtigten Hintergründe zum Plakat. Schmid erklärte, dass die freizügige Wassernixe nicht als provokative Werbestrategie bzw. aus einer Haltung gegen das weibliche Geschlecht gewählt wurde. Stattdessen sollte die Körperhaltung der Wassernixe Lebensfreude und Herzlichkeit verbildlichen: die weit ausgestreckten Arme sollten die Besucher der Badenfahrt 1977 willkommen heissen und Güte ausdrücken. Der dargestellten Freizügigkeit, den grossen Brüsten, den weiten Hüften und der schmalen Taille wurde gemäss Sepp Schmid weder Beachtung noch Empörung entgegengebracht. Damals, so Schmid, war man nicht so empfindlich.
Übelnehmen, keine Kritik geäussert zu haben, können wir es den Badenerinnen und Badenern nicht, denn die Wassernixe hat auch uns verzaubert. Nicht nur sie, sondern vor allem das Plakat ermöglichte uns einen unglaublichen Einblick in die Gesellschaft von 1977. Für uns steht fest, dass Plakate die Zeitkapseln der Moderne sind.
Arbeiterspind (1980-2000)

Der besprayte Arbeiterspind ist nicht nur irgendein Arbeiterspind aus der Industriezeit Badens, sondern sein Aussehen verrät uns schon, dass er eine ganz besondere Geschichte durchgemacht hat.
Die auffälligen, modernen Graffitis und der industrielle, alte Arbeiterspind passen vom Stil und dem Zeitalter her nicht wirklich zusammen. Der Grund dafür ist, dass er den Wandel von der Industrialisierung Badens zur Deindustrialisierung und somit die spätere Jugendbewegung Badens miterlebte und dazu gehört noch vieles mehr.
Zuerst wurde der Spind als Stauraum für die Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter der 1891 gegründeten Firma «Brown Boveri & Co» in Baden eingesetzt. Aber warum passierte dies genau in der Stadt Baden? Grund dafür waren die idealen Voraussetzungen der Stadt wie die guten Eisenbahnvernetzungen und das günstige Bauland. Das Unternehmen und die Belegschaft wuchsen stetig weiter, auch über die Landesgrenzen hinaus.
Die vielen Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter brauchten Spinde, um die eigenen Habseligkeiten und ihre Arbeitskleidung zu verstauen. Der besprayte Arbeiterspind war in der «Aktionshalle 36» aufgestellt. Er besteht aus robustem Metall inklusive mehreren Holztablaren und ist etwa 175 Zentimeter hoch.
Als die BBC in den 1980er Jahren eine Krise durchlief, war unter anderem Personalknappheit ein grosses Problem, denn wegen finanziellen Schwierigkeiten musste Personal abgebaut werden. Dementsprechend waren viele dieser Spinde überflüssig. Auch die Fusion der BBC mit der schwedischen Konkurrenzfirma ASEA zur ABB war ein eine grosse Änderung und ein entscheidender Schritt für Baden und seine Zukunft. Der Unterschied zwischen dem Spind im Historischen Museum und den anderen BBC Spinden ist jedoch, dass er, nachdem die Firma in Baden nicht mehr so erfolgreich war, nicht einfach weggeworfen, eingeschmolzen, oder in eine Lagerhalle gestellt wurde, sondern seinen Zweck anderswo in Baden gefunden hat.
In den 1980er Jahren herrschte nämlich die Zeit der schweizer Jugendbewegung. Dazu gehörte auch das Aufkommen der Jugendkultur. Immer mehr Partys und Veranstaltungen fanden statt und einige, wegen der Krise nicht mehr betriebene Industriehallen in Baden waren ideal für die Ideen der jungen Leute geeignet. Der Arbeiterspind hat auch zu dieser Zeit einen neuen Platz gefunden und wurde umfunktioniert, um den Betreibern der Veranstaltungs-Halle 36 als Putzschrank zu dienen.
Die Zeit war geprägt von Musik wie Techno oder Sportarten wie Skaten. Auch Graffiti und Sprayereien waren Teil der damaligen Jugendkultur. So wurde dem grauen und dunklen BBC-Arbeiterspind etwas Farbe verpasst. Die Graffiti peppten ihn auf, sodass er zu der damaligen Jugendkultur passte. Aber sie zeigen bestimmt etwas von der Lebendigkeit und der Ausgelassenheit, für die viele Junge während der Jugendbewegung kämpften. So trägt der besprayte Arbeiterspind immer ein Stück von der Badener Geschichte mit sich herum.
Eine wirkliche Bedeutung haben die Graffiti laut meinem aktuellem Wissensstand nicht, es handelt sich wahrscheinlich einfach um Tags, also Abkürzungen oder Pseudonyme, die von Sprayerinnen und Sprayern verwendet wurden. Schliesslich wurden damals oft Graffiti illegal an Mauern, Tunnelwände oder Brücken gesprayt. Wenn man den eigenen Namen hingesprayt hätte, hätte das zu Bussen oder gar Anzeigen geführt. Also verwendeten viele Künstlerinnen und Künstler sogenannte Tags, um ihre Kunstwerke zu kennzeichnen. Manche sprayten weder Bilder noch Messages, sondern taggten einfach nur Objekte. Beim Spind scheint es auch so gewesen zu sein. Man erkennt mehrere Tags, die mehrmals gesprayt wurden. Der Spind ist also ein gutes Beispiel für eine Subkultur wie das Sprayen, die Teil der Jugendkultur Badens in den 1980er und besonders in den 1990er war.
Schlussendlich wurde der Arbeiterspind anfangs des 21. Jahrhunderts dem Historischen Museum in Baden geschenkt und an einem schönen Platz mit Blick auf die Limmat ausgestellt, sodass er sich dort auch noch heute befindet. Somit können sich alle, die im Museum an ihm vorbeilaufen, daran erinnern, dass das heutige Baden ohne seine Geschichte nicht so wäre, wie es heute ist.
Svenja Dittli
Medaille (1982)

Im Historischen Museum Baden gibt es eine Medaille, die an der Badenfahrt 1982 an die Gewinner des Gestaltungswettbewerbs vergeben wurde. Die Medaille zeigt auf der Vorderseite eine Frau, die von einem blauen Hintergrund umgeben ist, welcher die Farben von Baden repräsentiert. Die Frau könnte auch auf die Schönheit und Anmut von Baden oder auf die wichtige Rolle von Frauen in der Geschichte und Kultur Badens verweisen. Das Medaillenband ist rot und weiss, wie das Badener Wappen. Das Design der Medaille unterscheidet sich von typischen Medaillen, die oft mit komplizierten Schnörkeln und Details verziert sind.
Leider konnten wir nicht herausfinden, wem diese Medaille verliehen wurde. Doch es ist möglich, dass es für das sogenannte Franzosenhaus vergeben wurde.
1982 war das Motto der Badenfahrt «Illusionen». Fast 6000 Personen waren an den Vorbereitungen für das Volksfest beteiligt. Vereine, Gemeinden und Quartiere liessen während den zehn Tagen Badenfahrt 84 Beizen auferstehen. Von ihnen wurde erwartet, dass sie am Umzug teilnahmen, der 4 km lang war und 3000 Personen mit 90 Illusionen beinhaltete. Neu war auch, dass es zwei Nachtumzüge gab.
Noch heute ist die Badenfahrt 1982 bekannt für das Franzosenhaus. Die Zunft zur Sankt Cordula baute ganz im Sinne des Badenfahrt-Mottos am südlichen Ende der Weiten Gasse das sogenannte Franzosenhaus mit Stadttor nach. Das Haus bekam seinen Namen, weil dort im 17. Jahrhundert der französische Gesandte in Baden wohnte. Obwohl es den Franzosen bald zu klein oder wenig pompös wurde und sie auszogen, wurde es in der Folge von anderen ausländische Gesandten und Gästen benutzt. 1982 wollte man es nun wieder aufleben lassen.
Badener Handwerker und Künstler bauten unter der Leitung von Bühnenbildner Toni Businger aus Stahlgerüst, Holz, Stoff und Leim eine Attrappe, die dem Motto «Illusionen» alle Ehre machte. Die Badenfahrt-Version des Franzosenhauses war zwar nicht ein genaues Replika des ursprünglichen Gebäudes, bei den Fesbesuchern und besonders bei Badens Bevölkerung stiess es aber auf grosse Begeisterung.
Das Badenfahrt OK jedoch war weniger begeistert, denn der Bau der Attrappe kostete CHF 20'000 mehr als budgetiert. Auch die Polizei war nicht sonderlich erfreut, denn die Dimensionen des Tores machten die Durchfahrt für Stadtbusse zum Risiko und erforderten eine Überwachung durch die Stadtpolizei.
Als das Franzosenhauses nach der Badenfahrt wieder abgerissen wurde, wurden Rufe laut, man solle doch ein richtiges Gebäude als Rekonstruktion des Franzosenhauses an dieser Stelle bauen. Auch 2011 gab es wieder Stimmen im Badener Einwohnerrat, welche einen Wiederaufbau des Franzosenhauses forderten.
Es ist also durchaus möglich, dass die Medaille für die Gestaltung des Franzosenhauses vergeben wurde. Es gab 1982 aber auch noch viele andere fantasievolle Beizen und Bauten. Wir sehen die Medaille deshalb als Symbol für die grosse Anzahl and atemberaubenden Illusionen, welche für die Badenfahrt 1982 gebaut wurden.
Paulina, Lilian, Michaela und Astrid
Glas Badenfahrt (1987)

Das kleine, runde Gläschen ist ein ganz normales Objekt, so hat es zuerst den Anschein. Doch hinter diesem Gläschen steckt eine Geschichte über eine Stadt, welche schon zur Römerzeit international Geschichte geschrieben hat: Baden. Was ist die genaue Geschichte dieses Gläschens und in welchem Zusammenhang steht sie mit der Stadt Baden?
Das kleine, runde Gläschen ist ein Shotglas mit einem aufgedruckten Logo der Badenfahrt 1987. Ewas darunter befindet sich ein weiteres Logo, auf dem ein Basketball und das Stadtwappen von Baden zu sehen ist. Bei diesem Logo handelt es sich um dasjenige des Basketballclubs Baden, welcher 1954 von Mitarbeitern der Brown-Boveri-Company gegründet wurde.
Die Brown-Boveri-Company (kurz BBC) war zu ihrer Zeit eine der grössten Industriebetriebe weltweit. Gegründet wurde die Firma 1891. Im Jahre 1987 fusionierte die BBC jedoch aus wirtschaftlichen Gründen mit der schwedischen Firma ASEA und die ABB wurde gegründet. Im selben Jahr fand neben der Fusion der zwei Weltfirmen auch eines der grössten Feste der Schweiz statt: Die Badenfahrt.
Im Sommer 1923 wurde in Baden ein Fest ins Leben gerufen, um den Badener Friedenskongress zu ehren, welcher dem Spanischen Erbfolgekrieg 1714 ein Ende machte. Man zelebrierte die Gemeinschaft der Badenerinnen und Badener.
14 Jahre später war Baden erneut Gastgeber eines Festes, an welchem man die Reise oder auch die «Fahrt» nach Baden feierte. So kam dieses riesige Volksfest zu seinem Namen: die Badenfahrt. Danach wurde das Fest alle zehn Jahre wiederholt und die Tradition wird noch heute weitergeführt.
So fand auch im Jahre 1987 eine Badenfahrt statt. Mit dem Motto «Bade fahrt ab!» wurde die ganze Stadt für zehn Tage in ein riesiges Festareal umgebaut. Es gab viele unterschiedliche Attraktionen, wie zum Beispiel der bekannte Umzug durch die Stadt. Über tausend Menschen zogen mit mehr als 90 Umzugswagen durch die Strassen und begeisterten die am Strassenrand stehenden Zuschauerinnen und Zuschauer.
Eine weitere Attraktion war der Lunapark. Dieser befand sich auf dem Schulhausplatz und auf dem Areal der Kantonsschule auf der anderen Seite der Hochbrücke. Der Lunapark bestand grössten Teils aus Achterbahnen, Gruselhäusern und Spielständen. Kein Wunder also, dass dieser Ort vor allem das jüngere Publikum anzog. Doch auch für die älteren Besucher gab es passende Attraktionen, wie die unterschiedlichen Theater oder die Essensstände mit kulinarischen Spezialitäten.
Das Betreiben dieser Attraktionen und Stände beanspruchte hohe Kosten und vor allem viel Aufwand. Die Kosten wurden durch Sponsoren, wie zum Beispiel der BBC gedeckt. Doch für das Bewirten der Lokale und Festbeizen waren besonders Freiwillige von naheliegenden Ortschaften wie Dättwil oder Ennetbaden anwesend. Auch Sportvereine wie der Fussball- oder der Volleyballclub Baden waren vertreten. Und um für den eigenen Verein zu werben, produzierte man zum Beispiel Gläser mit seinem eigenen aufgedruckten Logo. So tat es auch der Baden Basketballclub, wodurch genau dieses Shotglas entstanden ist.
Das kleine Gläschen erzählt uns somit nicht nur eine Geschichte über den Basketballclub, sondern auch über die Badenfahrt, eines der grössten Feste in der Schweiz, und über die BBC, eine der erfolgreichsten Industriebetriebe zu ihrer Zeit. Hinter einem unscheinbaren Gläschen steckt also die Geschichte einer historischen und vielseitigen Stadt namens Baden.
Glas Badenfahrt (1987)

Ein Shotglas mag auf den ersten Blick ein einfaches, alltägliches Objekt sein, doch es kann uns auch wertvolle Einblicke in die Vergangenheit gewähren. So ist es auch bei dem Shotglas des BBC-Basketballclubs, das während der Badenfahrt 1987 zum Einsatz kam. Durch das Studium dieses Objekts können wir mehr über das Leben in Baden und die Kultur der damaligen Zeit erfahren.
Das Shotglas des BBC-Basketballclubs ist ein kleines Glas mit einem Fassungsvermögen von etwa 2 cl. Es ist mit dem Logo des Vereins und dem Schriftzug «Basketball Club BBC Baden» bedruckt. Dazwischen befindet sich das ehemalige Logo des Vereins. Oben links steht das Motto der Badenfahrt 1987 «Bade fahrt ab!» Zwischen dem Logo des Clubs und dem Motto der Badenfahrt ist eine Figur mit roten Backen abgebildet, die zu fliegen scheint. Die Figur soll dem Motto «Bade fahrt ab!» entsprechen.
Was können wir durch dieses Shotglas über das Leben in Baden und die Kultur der damaligen Zeit erfahren? Das Glas zeigt, dass der BBC-Basketballclub eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft spielte.
1926 wurde in Genf der erste Basketballclub gegründet, gefolgt vom Schweizerischen Basketballverband 1929. In der Deutschschweiz konnte sich Basketball aber nicht wirklich gegen beliebtere Sportarten wie Handball durchsetzten, dafür im Tessin und in der Welschschweiz umso mehr.
Wie kam es denn dazu, dass ausgerechnet in Baden schon 1957 ein Basketballverein gegründet wurde? Der Grund ist die BBC, die 1891 als Brown, Boveri & Cie. (BBC) von Charles E. Brown und Walter Boveri in Baden gegründet wurde. Spezialisiert auf Elektrotechnik heuerte die BBC in den 1950er Jahren Arbeiter aus verschiedenen Regionen der Schweiz und dem Ausland an. Viele Arbeiter der BBC organisierten sich auch in der Freizeit. Sie lebten schliesslich weit weg von zu Hause, oft auch noch ohne ihre Familie. Sport gab ihnen etwas zu tun und war gut für die Gemeinschaft. 1957 wurde deshalb dann auch mit dem BBC Basketballclub einer der ersten Basketballclubs der Schweiz gegründet. Es gab aber auch noch andere BBC Sportclubs, z.B. einen Volleyballclub. Das Shotglas ist also ein Zeugnis für den Stolz, den die Menschen in Baden auf ihren Verein hatten, und die Bedeutung des Sports in der lokalen Kultur.
Das Shotglas ermöglicht aber auch Einblicke in die Badenfahrt, ein Fest, das alle zehn Jahre stattfindet und ein bedeutendes kulturelles Ereignis für die Region Baden ist. Zur Zeit der Badenfahrt 1987 war der BBC-Basketballclub fast auf dem Höhepunkt seines Erfolges – das Damenteam war bereits in der Nationalliga A, das Herrenteam schaffte dies zehn Jahre später. Wie viele Sportvereine war auch der BBC-Basketballclub auf Sponsoring angewiesen. Eine Beiz an der Badenfahrt bzw. Souvernirs wie ein Shotglas waren da willkommene Möglichkeiten, um Geld in die Clubkassen zu spühlen. Das Shotglas diente also nicht nur als Erinnerungsstück für die Besucher der Badenfahrt, sondern auch als Werbeträger für den Verein. Es zeigt uns deshalb auch, wie solche Volksfeste das gesellschaftliche Leben in Baden wiederspiegelten und auch prägten.
Die Bedeutung von Freizeitaktivitäten im Leben der Menschen in Baden wird durch das Shotglas verdeutlicht. Es unterstreicht, wie solche Aktivitäten und gesellige Zusammenkünfte einen wichtigen Teil des Alltags und der Kultur ausmachten. Während der Badenfahrt kamen Menschen aus verschiedenen Städten und Gemeinden zusammen, um gemeinsam zu feiern und sich zu amüsieren. Der BBC-Basketballclub war einer von vielen Vereinen, die an dieser Veranstaltung teilnahmen. Das Shotglas symbolisiert somit auch die Rolle, die Freizeitaktivitäten und gesellige Zusammenkünfte im Leben der Menschen in Baden spielten.
Die Betrachtung von Alltagsgegenständen wie dem Shotglas kann uns helfen, die Geschichte und Kultur einer Stadt oder Region besser zu verstehen. Sie ermöglichen es uns, eine Verbindung zu den Menschen und Ereignissen der Vergangenheit herzustellen und diese besser zu begreifen. Es ermutigt uns, weiterhin nach solchen Gegenständen Ausschau zu halten, um die Geschichten und Traditionen, die sie repräsentieren, lebendig zu erhalten und die Vergangenheit besser zu verstehen.
Fabian, Emil und Sébastien
Gasmaske (1989)

Die grösste Atomkatastrophe der Geschichte im Reaktor von Tschernobyl am 26. April 1986 führte zu einer Verseuchung der Atmosphäre, die weitläufig in ganz Europa Schäden anrichtete.
Obwohl der Bund die Auswirkungen kurz nach der Katastrophe in der Schweiz unterschätzte und keine zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen veranlasste, nehmen wir an, dass die Bevölkerung sich trotzdem vor Gefahren der Radioaktivität schützen wollte.
Unser Twistory-Objekt ist eine Dräger-Schutzmaske aus dem Jahr 1989. Den Kauf solcher Schutzmasken sehen wir als eine mögliche Massnahme, die von Badenerinnen und Badenern getroffen wurde, um sich vor den drohenden Atomwolken von Tschernobyl zu schützen.
Nach Messungen im Inland und erhöhter Radioaktivität in der Luft empfahl nämlich sogar der Bund den Verzicht von gewissen Konsumgütern zur Vorbeugung von Krankheiten. Vor allem vor Gemüse, Milch- und Fischereiprodukten wurde gewarnt.
Als sie erfuhren, was die radioaktiven Strahlen im Körper verursachen konnten, entschieden wahrscheinlich manche Bewohner und Bewohnerinnen Badens, sich ein Gasmaske zu besorgen. Damit hofften sie, Krankheiten vorbeugen zu können, falls der Ausnahmezustand eintreffen sollte.
Wie stand es denn um die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung nach Tschernobyl? Trotz widersprüchlicher Ansichten bezüglich der Auswirkungen des GAUs (grösster anzunehmender Unfall) von Tschernobyl auf die allgemeine Gesundheit werden heute viele Krankheiten, vorwiegend Krebserkrankungen, der Strahlenenergie zugeschrieben. Die britischen Strahlenbiologen Ian Fairlie und David Sumner rechnen weltweit mit 30'000 bis 60'000 zusätzlichen Krebstoten bis zum Jahr 2056 infolge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Viele Kinder litten unter Störungen der Gehirnfunktionen und die Zahl der psychischen Erkrankungen nahm nach der Katastrophe zu. Ausserdem stieg die Angst vor Fehl- und Mangelgeburten durch die Radioaktivität, weshalb rund 60% mehr Abtreibungen durchgeführt wurden.
Die Gefahr der Atowolken aus dem Osten war aber nicht der einzige Grund für BadenerInnen und Badener, sich eine Schutzmaske zu besorgen: Drei der fünf Schweizer Kernkraftwerke stehen im Aargau, weshalb er auch «Atomkanton» genannt wird. Nach dem Unglück in Tschernobyl waren deshalb viele Aargauerinnen und Aargauer aufgewühlt und hatten Angst, dass so ein Unglück auch in unmittelbarer Nähe passieren könnte.
Ein weiterer Grund für die Verbreitung von Schutzmasken war der Zivilschutz. Als Folge von Tschernobyl wurden Konzepte für den Notfallschutz erfasst und das Strahlenschutzgesetz erlassen. Der Zivilschutz danach nicht mehr nur für den Schutz gegen Kriegsauswirkungen, sondern auch für Katastrophenhilfe, also den Schutz der Schweizer Bevölkerung bei Katastrophen wie Kernreaktorunfällen, Erdbeben usw., zuständig. Sogenannte «Zivis» wurden auch mit Schutzmasken ausgestattet, welche sie bei einem entsprechenden Aufgebot tragen mussten.
Der Reaktorunfall in Tschernobyl verstärkte die Meinungsverschiedenheiten zur Nutzung der Atomkraft noch mehr. Die Befürworter meinten und meinen nach wie vor, dass die Atomenergie die umwelt- und naturfreundlichste, unerschöpflichste, billigste Energie ist. Die Gegner andererseits wurden in ihrem Zweifeln an der Sicherheit von Atomkraftwerken bestärkt. Es ging so weit, dass Menschen das Bau-Areal des Kernkraftwerkes Kaiseraugst 11 Wochen lang besetzten, um den Bau zu stoppen. Die verschiedenen Ansichten zur Atomkraft gibt es nach wie vor.
⭐️Boccia-Pokal (1991-1993)

Unsere Statue ist eine Siegestrophäe mit dem Namen ‘’Trofeo Frighetto’’, die von G. Gusseuf zwischen 1979 und 1989 erbaut wurde. Auf dem marmorierten Sockel prangt eine hölzerne und mit gold überzogene griechische Siegesgöttin Nike mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopf. Der Lorbeerkranz steht für eine besondere Ehre oder Auszeichnung. Unterhalb der Siegesgöttin ist ein kleiner Boccia-Spieler zu sehen. Diese Figur deutet die Sportart an, in der man diese Statue gewinnen konnte. Sie wurde nämlich von 1991 bis 1993 an Boccia-Turnieren der BBC an den Sieger des jährlichen Turniers verliehen.
Die Trofeo Frighetto dient nicht nur als physischer Beweis für den Sieg im Boccia Turnier, sondern sie ist auch ein kulturelles Symbol, da die Statue die Geschichte und die Traditionen des Boccia-Spiels sowie die künstlerischen Ausdrucksformen der Zeit, in der sie geschaffen wurde, einfängt. Die Verbindung von Sport, Kunst und Tradition in einem Objekt wie der Trofeo Frighetto bietet eine einzigartige Perspektive auf die Bedeutung von Wettbewerben und die Anerkennung von Exzellenz in verschiedenen kulturellen Kontexten.
Das Spiel des Boccia ist die italienische Variante des Boule-Spiels. Das Ziel des Spiels ist es, seine eigenen Kugeln möglichst nahe an eine kleinere Zielkugel, dem Pallino, zu setzten, bzw. die Kugeln der anderen Mitspieler vom Pallino wegzuschiessen. Boccia gehört zu den Präzisionssportarten.
In der Nachkriegszeit bot die in Baden heimische Firma Brown Boveri & Cie, viele Arbeitsplätze an. Da die Wirtschaft in den benachbarten Ländern der Schweiz von dem Krieg sehr geschwächt war, kamen viele Menschen als Gastarbeiter nach Baden. Ein grosser Teil der Gastarbeiter bildete Immigranten aus Italien. Die Gastarbeiter residierten in extra angefertigten Siedlungen. In Baden, Wettingen und Ennetbaden stiegen die Bevölkerungszahlen durch die italienischen Gastarbeiter rasant an und es wurden grosse Siedlungen mit Hochhäusern für die Gastarbeiter errichtet.
Die Italienischen Arbeiter brachten während ihres Aufenthalts auch einen Teil der italienischen Kultur mit. In ihrer Freizeit spielten sie oft Boccia oder andere Sportarten wie Fussball. Im Brisgi, einer Gastarbeitersiedlung, bauten die Gastarbeiter auf freien Grünflächen sogar ihre eigenen Boccia-Bahnen.
Auch kulinarische oder musikalische Traditionen wurden von den Gastarbeitern mitgebracht. Beispielsweise gab es laut der Bevölkerung im Brisgi exzellente Pizzen und den besten Espresso und, das Wichtigste, dass die Gastarbeiter die Schweizer im Brisgi freundlich empfangen würden.
Die positive Dynamik, die aus diesem Kulturaustausch in Baden und Umgebung entstand, half Vorurteile abzuschaffen und das Verständnis und den Respekt füreinander und zwischen den Kulturen zu fördern. Mit den Gastarbeitern und ihrer Liebe zum Boccia-Spiel wurde auch das Freizeitprogramm der BBC verändert. Von nun an konnten Arbeiter im BBC-Boccia-Club ihre Freizeit verbringen und sogar ihr Können an Wettbewerben und Turnieren testen. Die Gewinner wurden mit der Eingravierung ihrer Namen auf dem Marmorsockel der Trofeo Frighetto belohnt.
Oscar-Figur (2007)

Im Depot des Historischen Museums Baden fiel uns zwischen Antiquitäten und privaten Sammlungen eine schmale Holzkiste ins Auge. Sie war mit schwungvollen Linien verziert. Als wir den Deckel anhoben erblickten wir eine aus Metall gegossene Figur. Den Oscar. Er ist befestigt an einem schwarzen Sockel. Darauf steht in weiss geschrieben: Badenfahrt 2007. Nun kam die Frage auf wie ist eine solche bedeutenden Figur an diesen Ort gelangt? Und was hat es mit der Badenfahrt 2007 auf sich? In diesem Blogartikel begeben wir uns auf die Reise des Oscars und erfahren wissenswerte Informationen rund um die Figur und die Badenfahrt 2007.
1927 überlegten sich drei junge Herren die “Academy of Motion Picture Arts and Sciences” zu gründen, um die Krise in der Filmindustrie entgegenzuwirken. Eine Verleihung wurde auf die Beine gestellt, um die besten Schauspieler des Jahres zu küren. Als Trophäe wurden ihnen die heute weltweit bekannten Oscarstatue überreicht. Ein goldener Ritter mit Kreuzschwert in der Hand, welcher auf einer Filmrolle steht. Auch an der Badenfahrt 2007 spielte die Oscar Figur eine grosse Rolle, jedoch mit einer etwas anderen Symbolik.
Wie auch in den vorherigen Jahren wurde die Badenfahrt 2007 von dutzenden freiwilligen Helfer akribisch geplant. Der Prozess der Entwicklung hat sich über vier Jahre vollzogen. Die erste Sitzung fand am 24. März 2004 statt. Zu Beginn kam es zu sieben treffen, um die Motto Wahl zu bestimmen. Durch mehrmalige Wahldurchläufe entschied sich das OK-Team unter Marc Périllards Leitung für das Motto 2007 “Welt statt Baden”. Im späteren Verlauf kam das OK-Team jeden Monat zusammen, damit die Organisation schnell und sauber vonstattengehen konnte.
Die Umsetzung verlief weitestgehend ohne Vorkommnisse. Dies war vor allem der sehr genauen und hervorragenden Planung des Organisationskomitees zu verschulden. Die vielen verschieden Unterthemen, wie zum Beispiel eine Glamour- und Glitzerwelt, die Götterwelten ebenso wie eine Unter- und Halbwelt waren an dem Fest vorzufinden und bereitete jedem Besucher Freude. Eines der Highlighte war der Umzug durch die Stadt mit etwa 2000 Teilnehmern, die sich mächtig ins Zeug legten, um den Zuschauern ein magisches Erlebnis zu bieten. Es war eine bedeutende Badenfahrt. Nicht nur war es die erste im 21. Jahrhundert, sondern auch die erste mit mehrstöckigen Festbeizen. Ebenso hatte man in diesem Jahr sich daran gewagt, das Festgebiet zu vergrössern, und auch hinter den Bahnhof Beizen und Bühnen aufzubauen. Es war aber zwar eine Herausforderung, die vielen Besucher dort hinzulenken, doch am Ende war die Badenfahrt ein voller Erfolg.
Marc Périllard übergab als Danksagung jedem einzelnen OK-Mitglied eine aus Metall und Silber gegossene Oscar Statue, die einen Lorbeerkranz in den Händen hält. Damit das Geschenk einen persönlichen Touch mit sich trug, gravierte er in die Figur den jeweiligen Namen des Mitgliedes ein. Der Oscar steht auf einem schwarzen Sockel, auf dem eine Plakette montiert wurde. Dieses Schildchen war die damalige Festplakette der Badenfahrt 2007.
Mit dieser kleinen Aufmerksamkeit erkannte Marc Périllard die freiwillige Arbeit der Mitglieder an und zeigte ihnen wie wichtig ihre Hilfe an der Planung war. Zudem wurde die Arbeit mit einem grossen Fest zelebriert, welches auf der Ruine Stein stattfand. Da es die letzte Badenfahrt war, in der Périllard als Präsident fungierte, wurde ihm in Form einer schauspielerischen Produktion, einen Städteflug nach Spanien geschenkt. Als krönenden Abschluss liessen alle Anwesenden Himmelslaternen emporsteigen.
2018 wurde das Originalstück des Oscars dem Historischen Museum Baden übergeben, so wie viele andere wichtigen Gegenstände der Badenfahrt.
Julina und Valeria
Bierdeckel «Schwarzer Schimmel» (2017)

Die Festwirtschaft an der Badenfahrt spielt in Baden schon lange eine grosse Rolle. Dies ist auch der Grund, weshalb wir uns für einen Bierdeckel der Beiz «Zum Schwarzen Schimmel» der Spanischbrödlizunft entschieden haben, welcher von der Badenfahrt 2017 stammt. Doch nicht nur die Spanischbrödlizunft ist ein Teil von Baden, sondern auch die Spanischbrötli und die dazugehörige Bahn, welche die Stadt Baden kulturell und geschichtlich beeinflusst haben.
Der Bierdeckel ist rund und besteht aus Pappe. Auf der Vorderseite sind die Silhouetten zweier Pferde zu sehen, auf der Rückseite eine Fasnachtsmaske, um die «Baden – Spanischbrödlizunft» und «Zum Schwarzen Schimmel – Badenfahrt 2017» geschrieben ist.
Dieses Objekt tauchte an der Badenfahrt 2017 zum ersten Mal auf. Mit 1.2 Millionen Besucher*innen war die Badenfahrt 2017 ein riesiges Fest und breitete sich über die Innenstadt Badens aus. Sie gewährte Platz für 95 Beizen, die unter dem Motto «Versus» standen. Wie auch schon bei vielen Badenfahrten zuvor, nahm die Spanischbrödlizunft daran teil und entschied sich, das Thema der Badenfahrt durch einen Schwarz-Weiss-Kontrast zu präsentieren. So kam man auf Idee «Zum Schwarzen Schimmel», nach der ihre Beiz benannt wurde. Passend dazu zeigte ihr Logo Pferde-Silhouetten, welche auf dem Bierdeckel abgedruckt waren. Den Bierdeckel konnte man in der Beiz gegen ein Bier eintauschen.
Die Beiz «Zum Schwarzen Schimmel» wurde von 40 Menschen gebaut. Sie bestand aus einem Metallgerüst, welches eingekleidet wurde. Das Design war schwarz und weiss mit einigen orangefarbenen Elementen. Auf dem Gelände der Badenfahrt, welches in sechs Bereiche (Nord, Süd, Oben, Unten, Neu, Alt) eingeteilt wurde, stand die Beiz im Bereich «Alt». Insgesamt wurden 10'000 Franken investiert, aber durch die rekordbrechenden Besucherzahlen konnte sogar Profit gemacht werden.
Auch an der Badenfahrt 2023 wird die Zunft wieder mit dabei sein. Mit ihrem Ursprung an der Badener Fasnacht 1930 ist die Spanischbrödlizunft eine der älteren in der Geschichte von Baden. Damals fehlte ein Komitee, welches die Fasnacht organisierte. Eine Annonce in der Zeitung, ein Einführungstreffen, in welchem Statuten und Vorstandsnominationen vorbereitet wurden und eine Versammlung später war die Spanischbrödlizunft geboren. Schon nach weniger als einem Jahr wies die Zunft 220 Mitglieder auf. Bis auf eine Pause um den Zweiten Weltkrieg herum war die Zunft stets aktiv und verfestigte sich im Leben von Baden. Heutzutage organisiert sie Events wie die Fasnacht, die Cordulafeier, den Staatsakt, Querschläger-Aktionen oder das Badener Lichterwecken und ist Teil der Badenfahrt.
Den Namen «Spanischbrötli» findet man jedoch nicht nur in der Zunft, sondern auch in der Spanischbrötlibahn, deren Geschichte Mitte des 19. Jahrhunderts begann. Am 7. August 1847 fuhr das erste Mal ein Zug die Strecke von Zürich nach Baden. Er wurde Spanischbrötlibahn genannt, da mit diesem Zug auch eine grosse Anzahl an Spanischbrötli, ursprünglich ein Gebäck aus Mailand, von Baden nach Zürich transportieren wurden. Die Spanischbrötli waren nämlich ein beliebtes Frühstück bei den vermögenden Zürchern und konnte so frisch aufgetischt werden.
Die Bahn war jedoch nicht nur wichtig im Güter-, sondern auch im Personenverkehr. Sie trug zur wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung der Region bei. Auch heute noch ist die Bahn beliebt bei den Bewohnern der Stadt und ist ein wichtiger Teil der Kultur und Geschichte von Baden. Der Begriff «Spanischbrötli» ist also ein prägender Begriff der Badener Geschichte und kommt auch bei aktuellen Themen wie zum Beispiel der Badenfahrt vor.
Emma, Nina, Mikaela und Danilo
Rakete (2017)
Die Rakete der UniversAllbeiz der Gemeinde Ehrendingen war eine der grössten Attraktionen der Badenfah 2017. Mit einer Höhe von etwa 34 Metern überragt der Turm alle anderen Bauten in der Umgebung und wurde zu einem Wahrzeichen der Stadt. Die Badenfahrt 2017 war aber auch sonst sehr innovativ mit kreativen Bauten. «Versus», das Motto der Badenfahrt 2017, wurde vom dafürzuständigen Komitee gewählt, um auf die Gegensätze zwischen den verschiedenen Ständen und zwischen Alt und Neu/Stadt und Dorf/oben und unten zu verweisen.
Zurück zur Rakete: Während der Badenfahrt kamen Besucher aus der ganzen Region, um die Rakete zu besichtigen und eine Fahrt auf dem Turm zu unternehmen. Doch die Bedeutung der Rakete geht über ihre touristische Attraktivität hinaus. Die Betreiber der Rakete mussten sicherstellen, dass die Kosten für den Betrieb und die Wartung der Attraktion gedeckt wurden. Dies erforderte eine sorgfältige Planung und eine genaue Kalkulation der Kosten, um sicherzustellen, dass die Einnahmen aus den Ticketverkäufen ausreichen, um die Betriebskosten zu decken.
Der Bau des Raketenstands erforderte viel Planung und Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren, Architekten und Handwerkern. Der Turm wurde aus Stahlträgern und Holzkonstruktionen errichtet und auf einer stabilen Betonplatte verankert. Die Gondel wurde ebenfalls aus Stahl gefertigt und verfügt über Sicherheitsgurte und ein Schutzgitter, um die Passagiere zu schützen. Für den Bau wurde eine Genehmigung benötigt, da sich der Stand in der Innenstadt befand.
Einmal am Tag wurde die Rakete "gezündet". Pyrotechnische Effekte begleiten den Startvorgang der Rakete und schafften eine besondere Atmosphäre. Die Sicherheit der Passagiere hatte beim Betrieb der Rakete höchste Priorität, weshalb regelmässige Wartungsarbeiten durchgeführt wurden.
Medien und wissenschaftliche Publikationen über unser Twistory-Projekt
Badener Tagblatt: «Badenfahrt macht sie zu Detektiven» (22.6.2023)

https://www.badenertagblatt.ch/aargau/baden/baden-handgranaten-sexismus-und-alkohol-kanti-schueler-erforschen-erforschen-die-geschichte-der-badenfahrt-ld.2476898
Rundschau: «Badenfahrt-Twistory» (15.6.2023)

https://ihre-region-online.ch/wp-content/uploads/2023/06/RSN_2423_g.pdf
H-Teach: «When Students Rewrite History: A Twistory Project for Schools, Museums, and Archives» (5.2023)
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht: «Twistory – ein kooperatives Projekt für Museen und Sekundarstufe II» (5.2023)
Badener Neujahrsblätter: «Cholera und ihre Auswirkungen auf das Abwassersystem in Baden» (11.2022)
Badener Tagblatt: «Eine Gasmaske, eine Bettflasche und ein Damenhut: Kantischüler erforschen die Stadtgeschichte mit Archivobjekten» (13.6.2022)
E-Journal: «Stadtgeschichte hautnah erleben» (22.6.2022)